Vielfältig waren Äußerungen und Ereignisse, mit denen im Jahr 2024 der hundertjährigen Wiederkehr des Erscheinens von Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ gedacht wurde. Auch in diesem Jahr wird uns manche Bemühung um diesen Text erwarten, wiewohl nun eingebettet in die Erinnerung an das Gesamtwerk seines großen Autors 150 Jahre nach dessen Geburt. Die folgenden Überlegungen gehen aus von zwei sehr unterschiedlichen Formen des Umgangs mit diesem Text, die in einen Zusammenhang zu bringen sich deshalb lohnt, weil sie einen – in gewisser Weise überraschend – komplementären Ansatz verfolgen.
Beginnen möchte ich mit dem in dieser Rubrik in der Silvesterausgabe 2024 erschienenen, höchst lesenswerten Artikel „Zauberberg, wiedergelesen“ von Martin Mosebach, in dem der Frankfurter Schriftsteller „Thomas Manns Roman auf seine sprachlichen Mittel untersucht“ – und dies als Ergebnis einer neuerlichen Lektüre, fünfzig Jahre nach der ersten Begegnung mit diesem Text. Leitender Gedanke für Mosebachs Interesse ist die historische Situierung des Autors anhand der stilistischen Eigenheiten des Wortlauts des Romans. Gehört das Werk literarisch noch immer ins neunzehnte Jahrhundert? Ist Mann einer der „Letzten“ dieser Ära bürgerlichen Erzählens, in der man ihn gern verortet? Oder verdient der Verfasser des Zauberbergs es vielmehr, als ein „moderner“ Autor jenes zwanzigsten Jahrhunderts verstanden zu werden, an das ihn die Entstehungszeit des Romans verweist?
Bevor Mosebach sich seiner selbst gestellten Aufgabe widmet, rückt er den Text in eine Reihe von anregenden Bezügen – innerhalb wie außerhalb von Thomas Manns Werk. So liest er ihn als eine „Reflexion“ über die im Ersten Weltkrieg entstandenen „Betrachtungen eines Unpolitischen“, wobei man freilich berücksichtigen sollte, dass Mann die Niederschrift des (ursprünglich als Novelle konzipierten) Zauberbergs bereits 1913 begann, um sie 1915 für die Arbeit an seinen sehr zeitgemäßen Betrachtungen zu unterbrechen. Schon aus diesem Grund wird der Roman in einer Auseinandersetzung mit ihnen nicht aufgehen. Bedenkenswert erscheint Mosebachs Frage nach dem möglichen Einfluss einer Lektüre von Ernst Jüngers „Stahlgewittern“ vor allem auf die abschließende Schilderung des Kriegsgeschehens an der Westfront.
Settembrini, der redselig wandelnde Widerspruch
Aber auch weiter spannt er den historischen Bogen und entdeckt Gemeinsamkeiten zwischen dem Zauberberg und dem Welttheater des spanischen Barocks – ein Gedanke, der zu weiter gehender Differenzierung einlädt. Zu einem „Welttheater“ gerät die Handlung des Romans von ihrem Ende her, vom Weltkrieg, in den sie mündet. Das von ihr entfaltete Panorama der Welt trägt insofern einen unverkennbar historischen Index, während das spanische Barocktheater mit seinen der Zeit enthobenen Allegorien elementarer Mächte wie Tod oder Liebe und ihrem Agon untereinander das Leben in seiner zeitlosen Substanz zur Anschauung stellt. Wenn gleichsam in einer Tiefenschicht des Romans, die sich freilich erst hermeneutischer Analyse erschließt, auch im Zauberberg fundamentale und aller Geschichte vorausliegende Strukturmuster des Lebens zutage treten, auf denen die Handlung gründet und die diese Handlung zugleich sichtbar macht, dann tritt der gleichwohl bestehende Unterschied schon an den Eigenheiten ihrer Dramatis Personae zutage.
Auch der Zauberberg kennt durchaus allegorisch zu verstehende Figuren, so in Settembrini einen Repräsentanten der Aufklärung und in seinem Gegenspieler Naphta den Gegenaufklärer und bekennenden Reaktionär. Während der Widerstreit der allegorischen Agenten des barocken Welttheaters jedoch erst im dramatischen Agon zwischen ihnen zum Vorschein wie zum Austrag kommt, sind die genannten Akteure des Zauberbergs selbst bereits in sich widersprüchliche Figuren. Ihr hybrider Charakter, und dies macht ihre Eigenart aus, besitzt eine letztlich analytische Qualität.
Die Rede Settembrinis ist durchzogen von einem tiefen Widerspruch zwischen dem Aufklärer, der für universelle Menschenrechte eintritt, und dem dazugehörigen Demokraten, der seinen durchaus kriegerischen Nationalismus recht unverhohlen zu Markte trägt (ganz abgesehen davon, dass seine wohlklingende Rhetorik durch den Vergleich mit einem Leierkastenmann ihren Anspruch auf rationale Überzeugung nicht unerheblich einbüßt). Tritt in Settembrinis Gestalt das Widersprüchliche vermeintlich kohärenter Weltansichten hervor, spiegelt Naphta umgekehrt das Gemeinsame vorgeblich widerstreitender Weltdeutungen. Denn in dem streitbaren jüdischen Jesuiten vermischen sich unter anderem zutiefst christliche Auffassungen mit einem Chiliasmus, der unverkennbar marxistischen Vorstellungen ähnelt. Was sich schon hier zeigt, ist die auf analytische Durchleuchtung des Gegebenen angelegte Erzählung dieses Romans. Exemplifikation wird durch Exploration, Repräsentation durch Analyse ersetzt.
Der Erzähler gibt sich kurioserweise unwissend
Mosebachs Untersuchung der Sprache des Zauberbergs lässt sich als Stilkritik bezeichnen, wobei der Begriff Kritik etwa im kantschen Sinne nicht als Zurückweisung von Inakzeptablem gemeint ist, sondern als abwägende Betrachtung verstanden sein will. Ausdrücklich bekennt sich Mosebach dazu, nicht „diesem monumentalen Werk am Zeuge flicken zu wollen“ – welcher Absicht er weithin, wenn auch vielleicht nicht in jedem einzelnen Fall seiner aufmerksamen Lektüre des Textes gerecht wird. Deren Ergebnis ist jedenfalls eindeutig: Die Sprache des Zauberbergs gehört ins zwanzigste Jahrhundert; sie ist „modern“. Thomas Manns ostentativer Wille zu auffälligen Formulierungen, zu ironischen Archaismen, zur Bildung neuer Worte, zur Verwendung der bekannten in ungewöhnlicher, wo nicht verstörender Bedeutung – all dies sind Merkmale einer Redeweise, die den „Sprachexperimenten avantgardistischer Autoren“ nicht fernsteht. Das ist treffend beobachtet und plausibel an seinen historischen Ort gestellt.

Ansätze zu einem solchen durchgängig ironischen, „uneigentlichen Sprechen“, wie Mosebach sagt, finden sich womöglich schon im neunzehnten Jahrhundert. Tolstoi bemerkt zu Anna Kareninas Ehemann, er spreche immer so, als mache er sich lustig über jemanden, der ernsthaft so spräche. Aber – und das macht den entscheidenden Unterschied aus – das ist Figurenrede. Thomas Mann hebt solches Sprechen hingegen auf die Ebene des Erzählers. Und damit vollzieht sich eine Ebenenvermischung, die ihrerseits zu den Kennzeichen der Sprache des Zauberbergs gehört.
„Was ist die Zeit? Ein Geheimnis, – wesenlos und allmächtig. Eine Bedingung der Erscheinungswelt, eine Bewegung, verkoppelt und vermengt dem Dasein der Körper im Raum und ihrer Bewegung“ – so beginnt das sechste Kapitel. Man würde nicht sogleich auf den Gedanken verfallen, hier äußere sich der Protagonist der Handlung, bis es schließlich heißt: „Hans Castorp fragte so und ähnlich in seinem Hirn.“ Ausdrücklich gibt der Erzähler sich kurioserweise unwissend über den Wortlaut von Castorps Fragen. Insoweit handelt es sich eben auch um Erzählerrede. In der erstaunlichen Unwissenheit, die der Erzähler an den Tag legt, wird das Faktum zu Bewusstsein gebracht, dass sich im Grunde jegliche Figurenrede dem Autor verdankt. Die ambivalente Zuschreibung der Rede, die dieses Kapitel eröffnet, führt auf eine weitere Frage: Ist es der übermütige Castorp, der sich zu Überlegungen versteigt, die weit über seinen intellektuellen Verhältnissen rangieren? Oder ist es grundsätzlich vermessen, wo nicht naiv, derlei Fragen zu stellen? Was also haben wir von solcher Theorie zu halten? Dies bleibt unbeantwortet. Aber auch das ist eine Antwort.
Worin besteht der semantische Gewinn?
Die Frage, die sich indessen an den von Mosebach aufgedeckten sprachlichen Befund richtet, besteht darin, ob er in der von ihm überzeugend charakterisierten stilistischen Wirkung aufgeht. Denn es scheint, als bliebe ein Stück weit der semantische Effekt außer Acht, der mit der stilistischen Aufmerksamkeitserzeugung einhergeht – womöglich, weil er für die von Mosebach verfolgte Fragestellung von geringerem Belang ist. Gleichwohl mag es interessant sein, den unmittelbaren Zusammenhang zwischen den von Mosebach vermerkten, demonstrativ ungewohnten Formulierungen Manns und jenem analytischen Programm zu beobachten, dem wir bereits begegnet sind.
Präzise lässt sich Mosebach auf den Nachweis seiner These ein und weiß eine Fülle von Beispielen zu ihrem Beleg beizubringen. Frau Stöhr wird durchgängig als „ungebildet“ bezeichnet, doch dieses Epitheton beschränkt sich nicht auf die Charakterisierung ihrer Person, sondern findet, wie Mosebach bemerkt, „bei jeder Lebensregung“ ihrer Person Anwendung: Sie lacht ungebildet und hat ungebildete Tischmanieren. Aber worin besteht der semantische Gewinn dieser tendenziell zeugmatischen Wendungen? Sie bringen zum Vorschein, was das fragliche Partizip im Wortsinn besagt. Wir verstehen seine Bedeutung im Hinblick auf eine Person gemeinhin als Bezeichnung mangelnder Kenntnisse oder eines verstörenden Halbwissens. Doch in der Bildung steckt zunächst die Vorstellung von einer Formgebung. Ungebildet ist also das Ungestalte. Darin tritt eine Auffassung von Bildung zutage, wie sie etwa Humboldts Bildungsideal entspricht: die Formung des Menschen zu einer ästhetisch gelungenen Gestalt, in der die Bildung ihre Bestimmung findet. Das hier zugrunde gelegte Verständnis von Ästhetik weist insoweit über das sinnlich Wahrnehmbare hinaus und verbindet auf diese Weise Wissensreichtum mit Tischmanieren.
Assoziationen des Todes genährt
Besonders deutlich werden die semantischen Effekte auffälliger Ausdrücke dann, wenn sie von Mosebach explizit anhand von gleichsam normalisierten Formulierungen gemessen werden. Sie entsprechen in etwa dem, was die Franzosen le bon usage nennen, also der Norm „guten“ Sprachgebrauchs. Ein Bespiel auch hierfür: „‚Wo man die Ärzte noch länger an dem Sinnlosen hantieren sah‘ – gemeint ist der Besinnungslose, ‚hantieren‘ ist für ärztliche Hilfe eine ungewöhnliche Wahl.“ Dass es sich bei den von Mann benutzten Worten keineswegs nur um ungewöhnliche Synonyma der erwartbaren Begriffe handelt, wird umso deutlicher, wenn man den – zutiefst abgründigen – Kontext in Rechnung stellt, innerhalb dessen die beiden von Mosebach hervorgehobenen Ausdrücke stehen: „Der Hofrat selbst war bei der Mahlzeit zugegen, und er war es, der, zusammen mit der Mylendonk und einigen jungen, handfesten Tafelgenossen, den Ekstatiker, blau, schäumend, steif und verzerrt, wie er war, aus dem Saal in die Halle schaffte, wo man die Ärzte, die Oberin und anderes Personal noch längere Zeit an dem Sinnlosen hantieren sah, der dann auf einer Bahre davongetragen wurde. Ganz kurze Zeit danach aber sah man Herrn Popów stillvergnügt, in Gesellschaft seiner ebenfalls stillvergnügten Braut, wieder am Guten Russentisch sitzen und, als sei nichts geschehen, sein Mittagessen beenden!“ „Hantieren“ und der „Sinnlose“ (was, grammatisch gesehen, im Übrigen ebenso gut „das Sinnlose“ bedeuten kann) gehören insoweit metonymisch zusammen, als jede medizinische Hilfe sinnlos erscheint, weshalb sie über ein Hantieren an dem Unglücklichen auch nicht hinausgelangt.

Denn dass er „auf einer Bahre davongetragen wurde“, nährt unweigerlich Assoziationen des Todes. Die Abgründigkeit dieser Szene aber besteht darin, dass die scheinbar aussichtslose Behandlung eines moribund wirkenden Patienten nichts ausrichten zu können scheint, dies aber seiner sogleich erfolgenden Genesung keinerlei Abbruch tut. Was in diesem „Sprachspiel“ in nuce aufscheint, ist nichts anderes als eines der grundierenden semantischen Muster, um welche die Handlung dieses Romans kreist. Denn in seinem Zentrum steht die Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Leben, die in allen möglichen Varianten durchgespielt wird.
Zur Vernunft gehört die rationalem Kalkül geschuldete Technik, deren Einsatz als medizinische Kunst für eine Heilanstalt selbstverständlich erscheint. Doch ihre Leistungen bleiben kontingent. Ob die Maßnahme des Arztes greift oder nicht, ist schlechthin unabsehbar. Die Ursachen ihrer Wirksamkeit oder Unwirksamkeit lassen sich bestenfalls unzulänglich ergründen, und so kann der Erfolg intensivster medizinischer Bemühungen selbst bei geringerer Schwere der Krankheit ausbleiben, während der radikalste Versuch, eine Erkrankung herbeizuführen, misslingen mag. Dies ist der Fall von Ottilie Kneifer, die geheilt wurde, aber sich so heimisch im Sanatorium Berghof fühlt, dass sie unbedingt dortbleiben will. Allein, ihr Zimmer wurde wegen großer Nachfrage benötigt, und so verweigert man ihr weiteren Aufenthalt. Da sprang sie in ihrer Verzweiflung in den eiskalten See, um zu erzwingen, was man ihr verwehrte – doch umsonst. Ihre Gesundheit war widerstandsfähig wiederhergestellt. Nichts half, um die erfolgreiche Genesung rückgängig zu machen. Es ist eine solche Kontingenz medizinischen Erfolgs, die auch in der kleinen, schließlich unerwartet komisch ausgehenden Szene um den Ekstatiker Popów vom Guten Russentisch wie in einem Brennglas zum Vorschein kommt, wobei ungewöhnliche Formulierungen maßgeblich daran beteiligt sind, sie zum Ausdruck zu bringen.
Substitution des Verbs durch ein Substantiv
Die techne des Arztes dient der Erhaltung des Lebens, doch hat rationales Kalkül gleichermaßen die Maschinerie des Tötens ersonnen, weshalb die beiden Hauptorte der Handlung, das Sanatorium und das Schlachtfeld, einander gegensätzlich, doch zugleich komplementär zugeordnet sind. Auch die letztendliche Kontingenz des Todes herrscht hier wie dort. Denn ob der Soldat im Krieg der einander bekämpfenden Armeen überlebt, bleibt ebenso dem Zufall überlassen. Nicht zuletzt hierin hat es seinen Grund, wenn am Ende des Zauberbergs der Erzähler im Getümmel der Schlacht Hans Castorp aus den Augen verliert. Sein Schicksal bleibt unbekannt, auch wenn der Erzähler auf einen guten Ausgang nicht sehr hoch wetten möchte. Ausgeschlossen aber ist er nicht. Und so überantwortet der Erzähler seinen Helden, der zum Helden nicht zu taugen schien, schließlich dem unabsehbaren Regiment des Zufalls.
Der Zusammenhang von Medizin und Militär tritt sehr markant in einer der weiteren Formulierungen hervor, die Mosebach seiner stilkritischen Betrachtung unterzieht: „‚Nahm Seitenlage ein‘ statt: legte sich auf die Seite“. Was aber macht den Unterschied zwischen beiden Formulierungen, der geläufig wirkenden verbalen und der sich ein wenig manieriert ausnehmenden nominalen Wendung, aus? Die Substitution des Verbs durch ein Substantiv enthebt den vordergründig banalen Vorgang seiner alltäglichen Selbstverständlichkeit und verleiht ihm etwas Technisches. Sie spielt insofern auf die generelle Unterwerfung des Körpers unter ein strenges Reglement in dieser Heilanstalt an, die militärischer Disziplinierung korrespondiert. Ganz in diesem Sinn empfindet der begeisterte Soldat Joachim Ziemßen noch die streng verordnete tägliche „Liegekur“ als Teil seiner Dienstpflicht. Im Angesicht des medizinisch zu vermeidenden wie des militärisch zu erwirkenden Todes, der schon um dieses Zweckes willen den organisierten Schutz des eigenen Lebens verlangt, wird die rationale Ordnung eines strengen Reglements verfügt, das den gesamten Körper erfasst.
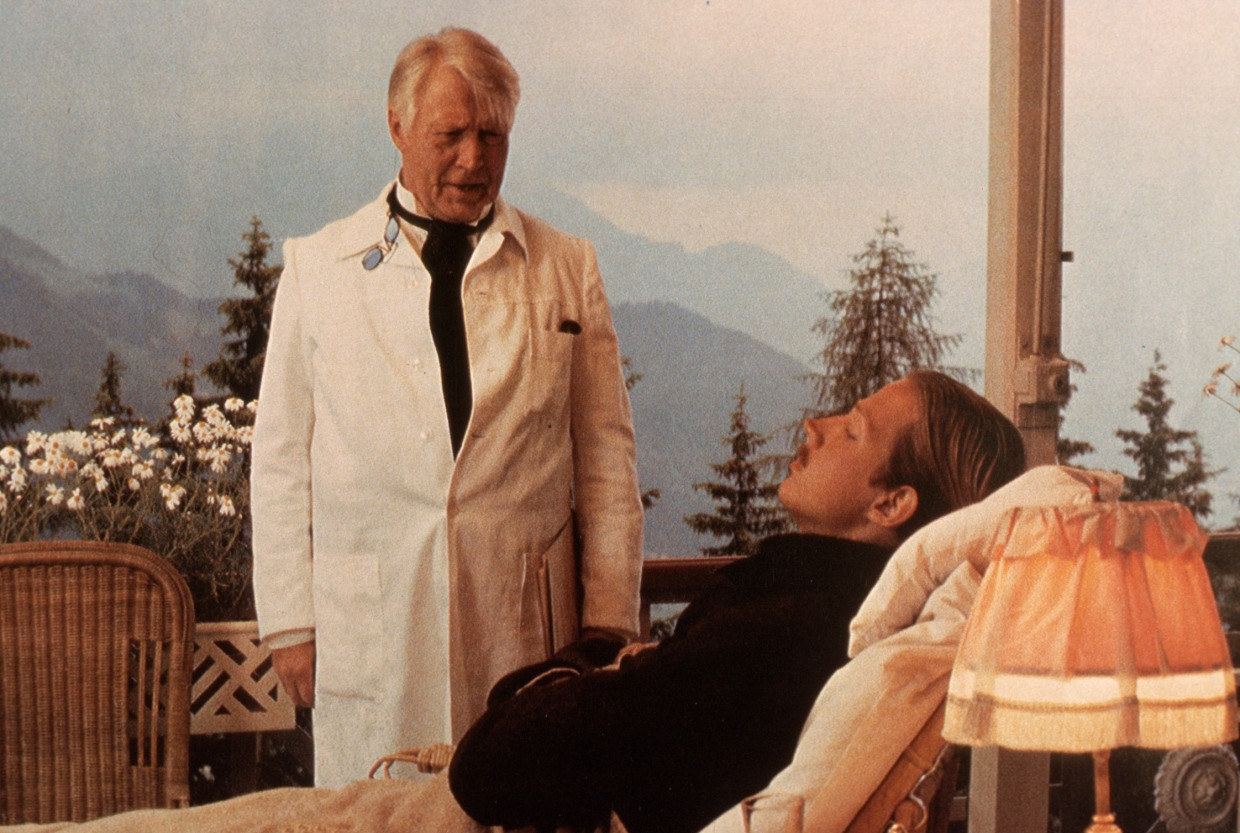
Thomas Manns analytisches Erzählen greift auf ostentativ ungewöhnliche Formulierungen zurück, die vermittels ihrer Apartheit anderweitig verborgen bleibende Zusammenhänge aufdecken. Eine solche Exzentrik des Sprachgebrauchs produziert ihrerseits ein analytisches Interesse und ruft die Frage nach dem Grund der Verwendung solch verfremdender Wendungen auf. Auch sie tragen damit zur Konstitution jener semantischen Tiefenschicht bei, welche die Handlung des Zauberbergs zur Erscheinung bringt: einer Metaphysik des zutiefst widersprüchlichen Lebens, das der Rationalität in unaufhebbarer Dialektik verschwistert bleibt. Die Vernunft ist ein Produkt des dem Tode geweihten Lebens; sie ist gleichsam um dessen Endlichkeit erkauft. So erscheint es nur schlüssig, wenn sie sich in Gestalt der ihr zu dankenden Technik ebenso in den Dienst dieses Lebens stellen lässt, wie sie dessen Ende herbeizuführen vermag. Eine Folge dieser Dialektik aber ist es auch, dass die Vernunft sich des dem Tode verfallenen Lebens stets nur unvollkommen bemächtigen kann.
„Ist der Zauberberg zu retten?“
Auch die von Mosebach herausgearbeitete und literarhistorisch überzeugend situierte experimentelle Stilistik einer programmatischen Transgression des bon usage gehört zu einem (im doppelten Sinn dieses Begriffs) analytischen Einsatz der Sprache, der mit den Mitteln der Erzählung die Welt ebenso zergliedert, wie der Tod das Leben im Zerfall des Körpers auflöst. Gewiss vermag das Erzählen versunkenes Leben ein Stück weit der Vernichtung zu entreißen und der Erinnerung zu bewahren. Doch dient es im Zauberberg gleichermaßen dazu, die Selbstverständlichkeiten dieses Lebens aufzulösen, um einen Durchblick auf seine fragilen Fundamente zu ermöglichen. Noch in der Technik des Erzählens steckt im Zauberberg die unhintergehbare Dialektik von Rationalität und Leben.
Gut zwei Monate vor Erscheinen von Mosebachs Artikel hielt Hans Ulrich Gumbrecht am 22. Oktober 2024 die achte Thomas Mann Lecture der ETH Zürich. Mit frappierend-gewinnender Aufrichtigkeit bekennt Gumbrecht, die Einladung angenommen zu haben, ohne den zur Debatte stehenden Zauberberg je gelesen zu haben. In der Tat, wer möchte sich rühmen, jeden Kanontext zu kennen? Man durfte also auf eine originelle Lektüre gespannt sein.
Ihre Intention macht der Titel von Gumbrechts Rede namhaft: „Ist der Zauberberg zu retten?“ Nun mag man sich fragen, ob angesichts von so viel Aufmerksamkeit im hundertsten Jahr nach seinem Erscheinen dies das dringlichste aller den Text betreffenden Anliegen darstellt. Aber die Sorge, ob ein so voraussetzungsreiches Werk auch bei der nachfolgenden Generation seinen kanonischen Status wird bewahren können, ist sicher nicht unberechtigt. Während der seit Langem mit dem Text vertraute Autor Mosebach in eindringlicher Lektüre eine weitere Facette des Faszinosums des Zauberbergs aufsucht, sorgt der Literaturwissenschaftler Gumbrecht sich um das fortdauernde Prestige seiner Neuentdeckung. Wie aber stellt er sich deren mögliche Rettung vor?
Konstanzer Rezeptionsästhetik 2.0
„Die“ Sekundärliteratur schiebt er zu diesem Zweck kurzerhand beiseite, wobei ein wenig offenbleibt, in welchem Umfang er sie hat zur Kenntnis nehmen können. Stattdessen soll uns das Heil des Romans von einer Lektüre herkommen, die ihn als „Vorlaufen in den Tod“ begreifen lässt. Eine solche Perspektive ist angesichts der Thematik des Zauberbergs womöglich naheliegend, nur gewinnt sie ihre eigentliche Signatur durch die Art ihrer Formulierung, steckt darin doch ein Zitat aus Martin Heideggers drei Jahre nach dem Zauberberg erschienenen Buch „Sein und Zeit“. Für die mit der Formel bezeichnete psychologische Integration des Todes in das Leben besitzt der Vortragende erkennbar viel Sympathie. Die Konfrontation dieses Konzepts mit Manns Roman will er zwar als Demonstration der Divergenzen und nicht der Konvergenzen zwischen beiden Texten verstanden wissen, doch in der konkreten Applikation auf den Text des Zauberbergs gerät Heideggers Modell denn doch zu einer Lektüreempfehlung für diesen Roman, der damit letztlich zum Vademecum einer Bewältigung der Angst vor dem eigenen Tod gerät. Weite Teile dieses ungeheuer theorielastigen Textes fallen damit notgedrungen unter den Tisch, allem voran das Gumbrechts Sicht nachgerade gegenläufige intellektuelle Faszinosum des Todes, um das der Zauberberg in seinem Kern kreist. Und so stellt sich die Frage nach der Distinktivität einer solchen Lektüre für genau diesen Text.
Hans Robert Jauß, Gumbrechts Doktorvater, hat mit der Begründung seiner Konstanzer Rezeptionsästhetik die Herstellung der Bedeutung eines literarischen Textes dem Leser übertragen. Ein solches Ermächtigungsgesetz setzt stillschweigend noch immer die Aneignung eines bestimmten Textes in seiner Eigenart voraus. Gumbrecht führt stattdessen so etwas wie eine Rezeptionsästhetik 2.0 vor (die allerdings vielleicht schon in der ursprünglichen Version angelegt war). Sie verwandelt den Text in kaum mehr als einen Anlass, mit Heidegger im Gepäck, etwas zu sagen, was man immer schon einmal, oder auch einmal wieder, äußern wollte. Ob dies ein gangbarer Weg sein könnte, den 1924 erschienenen „Zauberberg“, verfasst von einem Autor namens Thomas Mann, solchermaßen aufbereitet zu retten – bedürfte er tatsächlich seiner Erlösung aus drohendem Geltungsverlust –, bleibt fraglich. Am Ende von Gumbrechts Vortrag zögert man ein wenig, in den altbekannten Ruf einzustimmen: „Der Retter ist da!“
Von Andreas Kablitz erschien 2017 im Carl Winter Verlag das Buch „Der Zauberberg. Die Zergliederung der Welt“.







