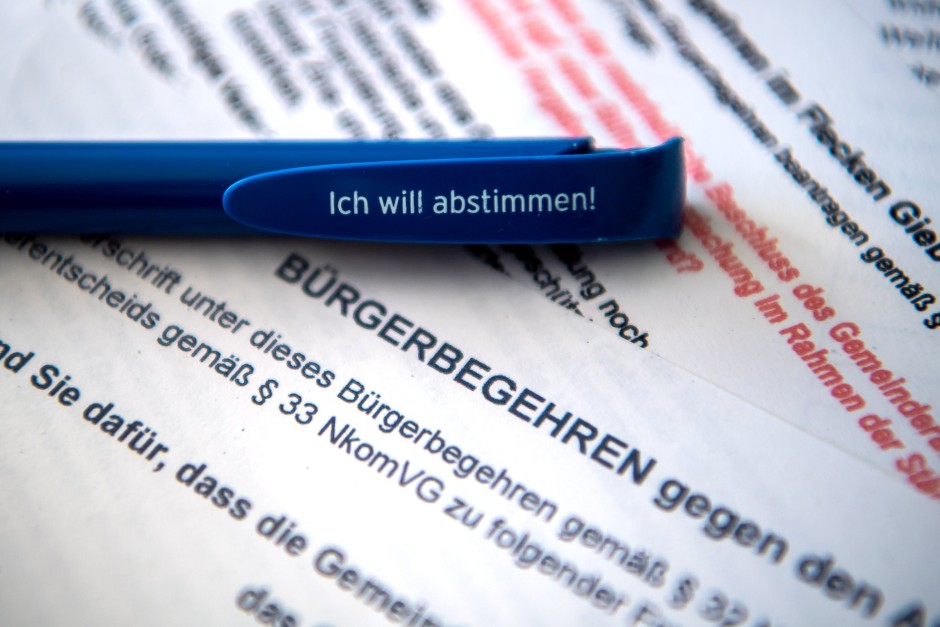
Der Plan der hessischen Landesregierung, die direkte Demokratie einzuschränken, bleibt umstritten. Das ergab am Mittwoch eine Anhörung im Hessischen Landtag zu einem vom Innenministerium vorgelegten Gesetzentwurf zur Reform des Kommunalrechts. Damit soll beispielsweise die Verzögerung von Infrastrukturprojekten vermieden werden, indem Bürgerbegehren ausgeschlossen werden, wenn in dem jeweiligen Verfahren eine Bürgerbeteiligung schon gesetzlich vorgeschrieben ist.
„Die Landesregierung liefert keine Belege für ihre Behauptung, dass Bürgerentscheide Infrastrukturprojekte grundlegend verzögern“, sagte Matthias Klarebach aus dem Landesvorstand des Vereins Mehr Demokratie. Seit 1993 hätten von 546 Bürgerentscheiden nur 60 Planfeststellungsverfahren betroffen. „Es mangelt an Empirie jenseits der Anekdote.“ Bürgerbegehren und -entscheide seien der einzige Weg, wie man sich zwischen den Wahlen verbindlich in der Gemeinde einbringen könne. „Statt neue Hürden aufzubauen, sollten wir bestehende abbauen“, so Klarebach.
Ein großes Hindernis sei der komplexe Kostendeckungsvorschlag, den die Bürger bereits bei der Initiierung eines Bürgerbegehrens vorlegen müssten. Hier hätten Bundesländer wie Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen bessere Lösungen. Dort erstelle die Gemeinde die Kostenschätzung.
Direkte Demokratie in Konkurrenz zu repräsentativen Entscheiden
Dass Bürgerentscheide konstruktiv wirken können, zeige das Beispiel der Stadt Bad Homburg. Dort hätten sich die Bürger im Jahr 2018 mit großer Mehrheit für eine U-Bahn-Verlängerung ausgesprochen. Ein solches Vorgehen sei nicht mehr möglich, wenn die geplante Gesetzesnovelle beschlossen werde, so Klarebach.
Anders sieht es Christoph Brüning, Direktor des Instituts für Öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität Kiel und Präsident des Landesverfassungsgerichts in Schleswig-Holstein: „Der Begrenzung der Gegenstände eines Bürgerentscheides ist zuzustimmen.“ Aus seiner Sicht stehen die direktdemokratischen Instrumente in einer Konkurrenz zu den normalen repräsentativen Entscheidungsprozessen. Das den Bürgern durch die punktuellen Abstimmungen eröffnete Gestaltungspotential fördere die Identifikation und die Zufriedenheit mit der Verwaltung, schwäche aber die Wirkmächtigkeit der gewählten Volksvertreter.
Es diene häufig der Durchsetzung individueller Interessen eines Teils der Ortsbevölkerung. Aber es unterliege nicht dem Ausgleich von Interessen, für den die Volksvertretung sorgen müsse. Dies gelte vor allem für komplexe Abwägungsentscheidungen im Planungs- und Umweltrecht. Brüning unterstrich die „teilweise bereits eingetretene Gefahr einer Verlagerung bürgerschaftlicher Mitwirkung weg von den Gemeindevertretungen hin zu Bürgerinitiativen“. Ohnehin engagiere sich nur ein gewisser Prozentsatz der Bürger in der Selbstverwaltung einer Gemeinde.
Negative Auswirkungen auf Wahlbeteiligung vermutet
Der Einsatz direktdemokratischer Instrumente eröffne die Möglichkeit, bei vom Einzelnen als wichtig wahrgenommenen Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Dafür seien aufwendige Kommunalwahlverfahren, langwierige Gremiensitzungen, komplizierte Kompromiss- und Mehrheitsfindungen und die Beschäftigung mit als uninteressant eingeschätzten Themen nicht nötig.
Auf der anderen Seite verlören Gemeinde- und Stadtvertretungen ihre Sichtbarkeit im öffentlichen Diskurs, weil sie bei wesentlichen Fragen der Kommunalpolitik überspielt werden könnten. Dies könne Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung haben, da die Bürger das Wirken und die Bedeutung der Gemeindevertretung weniger stark wahrnähmen.
Brüning wies darauf hin, dass die Wahlbeteiligung im Zeitraum von 1956 bis 1989 bei den Wahlen der Stadtverordneten in Hessen stets zwischen 80 und 75,8 Prozent, bei Kreistagswahlen sogar zwischen 84 und 77,1 Prozent gelegen hätten. Doch seit dem Jahr 1993 sei die Wahlbeteiligung sukzessive gesunken. Erst 2006 habe sie sich bei etwa 50 Prozent eingependelt. „Ob hier ein Zusammenhang mit der Einführung des Bürgerbegehrens und -entscheides im Jahr 1992 besteht, ist offen“, so Brüning. Jedenfalls hätten die Instrumente die Wahlbeteiligung nicht stabilisiert.







