Am 5. Dezember um 20.22 Uhr schickte der Vize-Chef der FDP im Bundestag, Konstantin Kuhle, der F.A.Z. eine Whatsapp-Nachricht. „Ich habe heute bis Mitternacht Sitzungsdienst“, begann Kuhle, er saß also gerade im Parlament. Das tagte an jenem Abend bis spät. Soeben habe er sich gefragt, ob eine Zeitung schon mal eine Story über die letzten Reden von Abgeordneten gemacht habe.
Es passiert selten, dass Abgeordnete sich bei Journalisten melden, wenn es weder um sie selbst noch um ihr Fachgebiet, ihre Partei oder angebliche Stümpereien der Konkurrenz geht. Was hatte Kuhle bewegt? Die Liveübertragung aus dem Bundestag, um ein paar Minuten zurückgespult, zeigte es: ziemlich leere Reihen, müde Gesichter, ein mausgraues Thema, die Versorgung von Menschen mit seltenen Krankheiten. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki kündigte mit wissendem Lächeln die nächste Rednerin an. „Die gute Besetzung bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lässt mich vermuten – das kann ich auch ankündigen –, dass die Kollegin Maria Klein-Schmeink, Bündnis 90/Die Grünen, nun ihre letzte Rede im Parlament hält.“
Klein-Schmeink, 67, Vize-Chefin der grünen Fraktion, seit 15 Jahren im Bundestag, hatte schon vor einem Jahr verkündet, nicht mehr anzutreten. Sie geht im Guten. Aber sie geht. Und wie viele Abgeordnete, die gehen, hielt sie eine Abschiedsrede. Sie dankte dem CSU-Mann, der an diesem Abend die seltenen Krankheiten auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Sie forderte, die Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren ernster zu nehmen, und sie versprach, sich auch künftig zu engagieren. Am Schluss lächelte sie, verlegen, gerührt. Ein bisschen so, wie ein Angestellter an seinem letzten Arbeitstag, bevor er die Blumen bekommt und der Sektkorken ploppt.
Wie Losungen für den weiteren Weg der Kollegen
Als die Grüne fertig war, klatschten viele. Auch Kuhle. Er stand dafür sogar auf, wie die Grünen. Später hielten noch andere ihre letzten Reden. Als wieder ein Abgeordneter Applaus erntete, kommentierte Parlamentsvize Kubicki: „Es ist immer wieder schön, so viel Herzenswärme im Parlament zu erleben. Ich bin ganz gerührt.“ Er klang wie ein Chef, wenn sein Team einem Kollegen zum Abschied ein Ständchen singt.
Ein paar Wochen später: ein FDP-Abend, auch Kuhle war da. Angesprochen auf das Thema, sagte er, dass ihn Abschiede im Bundestag berührten. Andere Liberale, die dabeistanden, stimmten zu. Die letzten Reden seien so etwas wie Losungen, die einem die Kollegen auf den weiteren Weg mitgäben. Und irgendwie versichere man einander auch, dass man trotz allen Streits dasselbe wolle, nämlich Deutschland voranbringen. Die, die weitermachten, fühlten sich in solchen Momenten verbundener als sonst.

Jetzt, eine Woche vor der Bundestagswahl, sind alle letzten Reden gehalten. Es waren Dutzende. Urgesteine verabschiedeten sich, zum Beispiel der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, CSU. Er saß 34 Jahre im Bundestag. Oder die Grüne Renate Künast, ehemalige Landwirtschaftsministerin und Fraktionsvorsitzende, 23 Jahre im Parlament. Aber auch Neulinge sagten schon wieder tschüss, zum Beispiel der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert; er war einmal die Riesenhoffnung seiner Partei. Nun ist er krank, kann nicht weitermachen. Für seine letzte Rede kam er am Dienstag noch einmal ans Pult.
Viele wussten bis vor ein paar Tagen nicht, ob ihre letzte Rede wirklich die letzte sein würde. Denn die Fraktionen teilen ihre Redezeit danach auf, wer zu welchem Thema etwas sagen kann. Käme ein Fachgebiet unverhofft noch mal auf die Tagesordnung, dürfte der Experte vielleicht ein weiteres Mal ran. So ging es dem FDP-Digitalpolitiker Manuel Höferlin. Er tritt nach elf Jahren nicht mehr an. Ende Januar verkündete er zerknirscht, das sei jetzt „die fünfte letzte Rede, die ich halte“. Schon am 19. Dezember erklärte er: „Es gibt Dinge, mit denen man nicht rechnen kann, zum Beispiel damit, dass ich hier heute meine dritte letzte Rede halte.“ Seine erste letzte Rede hielt er am 13. November.
Warnung vor allzu ausführlichen Abschiedsworten
Lieber doppelt als gar nicht – dabei sind die Schlussworte keine Pflicht. Die Politiker dürfen auch sang- und klanglos gehen. Aber die meisten wollen persönlich werden. Die Abschiedsrede ist eine Grauzone. Sie handelt vom Menschen in der Politik – dem Leben als Abgeordneter, der Freude an der Demokratie, aber auch der Sorge um sie. Viele Parlamentarier wollen kaum mehr aufhören zu reden. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und ihre Vizes gehen zunächst mild, dann strenger dazwischen. Als die Linke Anke Domscheit-Berg im Dezember ihre letzte Redezeit überzog, mahnte Petra Pau erst sie – „Frau Kollegin“ –, dann alle: „Im Moment liegen wir mit dem Sitzungsende der heutigen Sitzung bei 3.40 Uhr.“ Also nachts. Sie gehe davon aus, dass das diszipliniere.
Auch Kubicki warnte schon vor allzu ausführlichen Abschiedsworten. Ende Januar unkte er: „Wenn alle, die heute ihre letzte Rede halten, die Redezeit genauso überziehen wie einige Kollegen vorhin schon – ich bin heute sehr großzügig –, dann sind wir statt bei einem Sitzungsende um ein Uhr bei drei Uhr.“ Als bald danach auch die CDU-Politikerin Monika Grütters ins Reden kam, versuchte er es noch einmal: „Frau Kollegin Grütters, Sie sehen, meine Langmut ist nahezu unendlich, weil ich Sie sehr schätze. Aber ich darf darauf hinweisen: Wir haben eine Vielzahl von letzten Reden.“
Aber fast immer beweist das Präsidium Geduld. Mehr noch: Manche Vizes antworten ihrerseits mit kleinen Würdigungen. Besonders Katrin Göring-Eckhardt, Aydan Özoğuz und Yvonne Magwas tun das gern. SPD-Frau Özoğuz lobte den grünen Abgeordneten Wolfgang Strengmann-Kuhn, 17 Jahre dabei, für seinen „immer fairen Umgangston“. Magwas dankte Künast „für Ihre klare Haltung für Demokratie“ und „persönlich“ recht herzlich „für Ihren konsequenten Einsatz gegen Hasskriminalität im Netz“.

Die Grüne Göring-Eckhardt verabschiedete den SPD-Mann Karamba Diaby, elf Jahre dabei, besonders herzlich. Er ist der erste schwarze, in Afrika geborene Bundestagsabgeordnete. „Sie werden diesem Haus fehlen“, betonte die Vizepräsidentin. Diaby habe immer bereitgestanden, wenn andere angegriffen worden seien. Dabei sei er selbst Opfer von Angriffen geworden, habe zeitweise nur unter Polizeischutz seine Arbeit tun können. Diaby war vielfach rassistisch beschimpft worden, hatte Morddrohungen bekommen. Göring-Eckhardt dankte „für Ihren Einsatz für Deutschland“. Viel Applaus.
Auch Abgeordnete loben andere Abgeordnete. Als der CDU-Mann Volkmar Klein und sein SPD-Kollege Niels Annen sich gerade verabschiedet hatten, begann der nächste Redner, Dietmar Bartsch von der Linken, mit einem Dank an „Volkmar und Niels“. „In dem Fall kann ich wirklich sagen, dass Sie auch mit der Opposition ordentlich umgehen, was nicht immer der Fall ist.“
„Auf Wiedersehen in Russland!“
Und die AfD? Ist auch dabei. Nachdem Barbara Benkstein kurz vor Weihnachten ihre letzte Rede gehalten hatte, antwortete ihr Magwas – die als CDU-Politikerin für ein AfD-Verbotsverfahren kämpft – freundlicher, als ein trockenes „Danke“ geklungen hätte. Sie dankte für Benksteins parlamentarische Arbeit, wünschte „alles, alles Gute für Sie und Ihre Familie“ und dass sie eine gute neue Aufgabe finde. Benkstein hatte allerdings auch versöhnlich Abschied genommen, vielen gedankt und nicht etwa von „Remigration“ schwadroniert, sondern Deutschland ein Digitalministerium gewünscht.
Aber das ist die Ausnahme. Wenn jemand aus der AfD geht, klatschen höchstens einzelne aus anderen Fraktionen. Zum Beispiel bei Albrecht Glaser, 83. Er ist einer von nur vier AfD-Abgeordneten, die im vergangenen Juni der Rede Selenskyjs im Bundestag zuhörten. Nun bedankte er sich bei „allen, die guten Willens sind“ – das konnte auf sich beziehen, wer wollte. Ein paar aus Union und FDP taten es.
Aggressiver verabschiedete sich Jürgen Pohl. Er bedaure, nicht mehr im nächsten Parlament zu sitzen, „wenn diese linke Beschäftigungstherapie endlich Geschichte ist“. Pohl kassierte Zwischenrufe, vor allem aus der Union: Es sei „eine gute Nachricht, dass das Ihre letzte Rede ist“, rief einer, und ein anderer: „Auf Wiedersehen in Russland!“ Pohl gilt als russlandnah; so sehr, dass er bei der Vertrauensfrage für Scholz stimmte, weil er Merz wegen dessen Vorhaben, der Ukraine Taurus zu liefern, noch schlimmer findet.
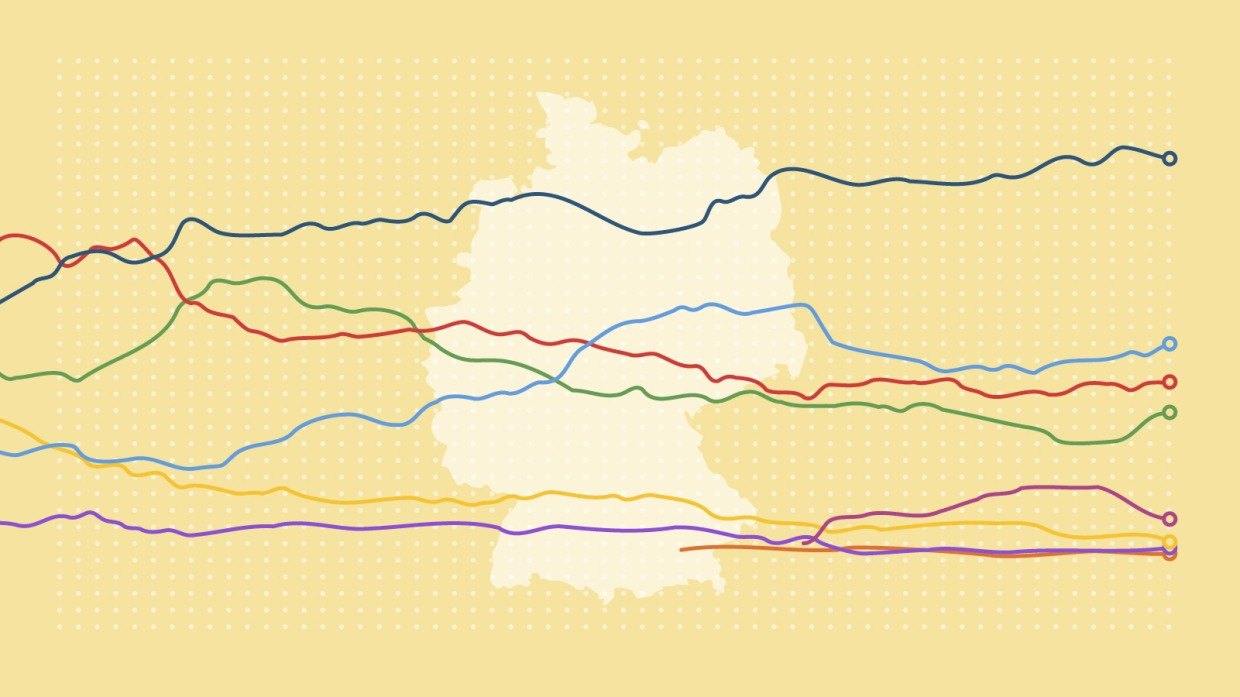
Die AfD grätscht ihrerseits gern in die Abschiedsreden anderer hinein. Als der Grüne Kai Gehring gerade mit den Worten eröffnet hatte, dass er dem nächsten Bundestag auf eigenen Wunsch nicht mehr angehören werde, rief aus der AfD Stephan Brandner rein: „Das ist schon mal eine gute Idee!“ Gehring fuhr fort: „Fünfmal als MdB gewählt worden zu sein . . .“ Brandner: „Der beste Teil der Rede bis jetzt!“ Gehring ließ sich nicht beirren: „Für mich war es eine große Ehre und ein Privileg, fünfmal gewählt worden zu sein.“ Brandner: „Um Gottes willen!“ Als Gehring Familie und Freunden dankte, für die er nun wieder mehr Zeit habe, ätzte Brandner: „Die werden sich freuen!“
Der AfD-Mann ist berüchtigt für seine penetranten Zwischenrufe. Gern krähte er in den vergangenen Wochen auch „letzte Rede“, wenn Abgeordnete der FDP oder der Linken ans Pult traten, die wiedergewählt werden wollen. Sollte heißen: Eure Parteien sind bald weg vom Fenster und ihr gleich mit.
Aber Brandner stört sowieso oft. Die anderen lassen sich davon nicht das Ritual verderben. Denn es geht ja um was. Jedenfalls meistens. Die letzten Reden sind fast immer ernst; lustig, gar ausgelassen spricht kaum jemand. Einer der wenigen war im Dezember Takis Mehmet Ali, SPD, 33, nur drei Jahre im Bundestag. Der Sozialpolitiker verabschiedete sich mit dem üblichen Dank, dem er eine Reihe launiger Kopfnoten für Kollegen folgen ließ: einem CDU-Mann, der mit ihm im Petitionsausschuss gesessen hatte, attestierte er, äußerst belastbare Stimmbänder zu haben, „weil er sich einfach zu jeder Petition irgendein Drama einfallen ließ und das auch aussprach“. Eine Grüne charakterisierte er als „Überzeugungstäterin“, die „einfach etwas zu spät geboren“ worden sei. Er habe sie sich häkelnd in Plenarsitzungen vorgestellt. „Corinna, du bist mein Lieblingsfundi“, rief er ihr zu. Heiterkeit bei den Grünen.
Keine Entschuldigung vonnöten
Die FDP-Fraktion beschrieb Mehmet Ali als eine „Problemschulklasse“, dankte aber trotzdem einigen: „Es war ja irgendwie lustig mit euch.“ Das provozierte den FDP-Mann Reinhard Houben zu dem fröhlichen Zwischenruf: „Ja, wir sind auch lustig“, was wiederum seine Parteifreunde johlen ließ. Viele schienen erleichtert, überhaupt noch zusammen lachen zu können nach Krisenjahren, Koalitionskrach und Ampelbruch.
Vizepräsidentin Özoğuz würdigte den Aufsteiger – Hauptschule, Fachabi, Bachelor, Master, aktuell im Promotionsverfahren – mit mütterlicher Nachsicht. Er sei nur kurz Abgeordneter gewesen, „aber ich denke, wir alle wünschen Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg“. Den hat Mehmet Ali inzwischen schon angetreten. Ende 2024 legte er sein Bundestagsmandat nieder und begann seinen neuen Job: als Sozialdezernent des Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Mit halb heiteren, halb ernsten Worten ging der CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer. 23 Jahre saß er im Bundestag. Er habe sich gefragt, ob er sich mit Blick auf diese Zeit bei jemandem entschuldigen müsse, sagte Grosse-Brömer Anfang Dezember. Dann sei ihm die Weisheit der HSV-Legende Uwe Seeler eingefallen: „Also, ein normales Foul ist nicht unfair.“ Dieser Maxime des „Hamburger Philosophen“ folgend, komme er zum Schluss: keine Entschuldigungen nötig. Das konnte man als Mini-Grundsatzrede zu den Regeln politischen Streits deuten. Überhaupt hatte Grosse-Brömer sich Gedanken zum Miteinander im Parlament gemacht. Er ließ ein weiteres Zitat folgen, diesmal berief er sich auf „Königin Elisabeth“. Die habe gesagt: „Ich bevorzuge altbewährte Tugenden: gut voneinander reden, andere Ansichten respektieren, zusammenkommen, um Gemeinsamkeiten zu suchen, und nie das große Ganze aus dem Blick verlieren.“ Der Christdemokrat rief dazu auf, sich daran immer mal zu erinnern.
Auch Ramsauer brachte Zitate zu dem Thema. Helmut Kohls Lieblingsspruch sei gewesen: „Wahr ist dies und jenes. Wahr ist aber auch dies und jenes andere.“ Diese Uneindeutigkeit der Welt erfordere von Politikern, tolerant und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Außerdem plädierte der Bayer für mehr Fairness. Wolfgang Schäuble habe den Parlamentariern ins Stammbuch geschrieben: „Wir müssen uns gegenseitig ertragen können.“ Der rauer gewordene Umgangston in der Politik besorgt in diesen Tagen viele Abgeordnete. Manche treten auch deshalb nicht mehr an.
„Achten Sie auf Ihre Gesundheit!“
Andere Abgeordnete warnten noch grundsätzlicher. Der Sozialdemokrat Bernd Westphal berief sich auf eine Schiller-Inschrift am Theater in Hildesheim, seiner Heimatstadt: „Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie, sie sinkt mit euch. Mit euch wird sie sich heben.“ Seine Fraktionskollegin Gabriele Katzmarek sieht Kräfte am Werk, die versuchten, „unserer Demokratie zu schaden und sie lächerlich zu machen“, auch indem sie den Plenarsaal zum „Pöbelhaus“ machten und „als Filmstudio für Fake News“ missbrauchten. Die Grüne Susanne Menge bat inständig: „Kämpfen Sie weiter für unsere Demokratie“, der CDU-Politiker Ingo Gädechens forderte, dass die Abgeordneten immer darauf achten mögen, „dass Respekt, Achtung und Mitmenschlichkeit nicht unter die Räder kommen“.
Einen Wunsch fügte er hinzu: „Achten Sie auch auf sich, achten Sie auf Ihre Gesundheit!“ Ein großes Thema: Politiker, die mit vor Müdigkeit kleinen Augen, vor Stress brummenden Köpfen, vor Sorge rasenden Herzen über die Zukunft des Landes entscheiden. Viele versuchen gegenzusteuern, joggen morgens um sechs oder verzichten abends auf Wein. Die Linke Domscheit-Berg warb zum Abschied noch einmal dafür, dass Politiker im Plenum Wasser trinken dürfen. Das ist bislang nicht erlaubt. „Wasser in Bundestagsflaschen verletzt die Würde des Hauses nicht. Aber zu wenig zu trinken, ist nicht nur gesundheitsschädlich, es verringert auch die Konzentrationsfähigkeit und damit die Qualität unserer Arbeit.“
Andere ließen durchblicken, welche Opfer der Beruf im Privaten fordert: 16-Stunden-Arbeitstage in Berlin, die Liebsten oft Hunderte Kilometer weit weg. Der Grüne Markus Kurth dankte seiner „langjährigen – inzwischen geschiedenen – Ehefrau“, der er weiter sehr verbunden sei. Dass sein Sohn so behütet aufwuchs, sei vor allem ihr Verdienst; und auch der Junge habe einiges mitmachen müssen: „Vielen Dank, Jonas und Sabine!“ Beifall aus allen Fraktionen.
„Lassen Sie uns für unsere Demokratie weiterkämpfen“
Die letzten Reden verbinden auch, weil sie offener sind als die meisten davor. Die Redner müssen keine Konkurrenten mehr übertrumpfen, keine Journalisten beeindrucken, keine Wähler anwerben. Sie sprechen davon, was ihnen grundsätzlich wichtig war und ist. Oft geht das im politischen Streit unter. Jetzt, am Ende, blitzt es hervor.
Und dann ist Schluss. Auch letzte Reden enden einmal. Viele bekunden, bevor sie vom Pult abtreten, noch einmal ihre Dankbarkeit oder ihren Respekt vor dem hohen Haus. Der CSU-Mann Erich Irlstorfer, elf Jahre dabei, schloss mit „Ich bedanke mich für wunderbare Jahre“, die Grüne Katja Keul mit „Es war mir eine Ehre“. Der Liberale Manfred Todtenhausen, bekannt für seine Vielseitigkeit – er ist unter anderem Gründer der Tiernothilfe „Dackel/Teckel in Not“, außerdem als Elektroinstallateur einer der wenigen Handwerker im Bundestag –, verabschiedete sich mit den Worten: „Gott schütze die Demokratie, Gott schütze das ehrbare Handwerk!“
Auch andere enden staatstragend. „Deshalb lassen Sie uns für unsere Demokratie weiterkämpfen“, schloss der Sozialdemokrat Diaby. Einige kündigen ihre Zukunftspläne an. Nebulös der Grüne Strengmann-Kuhn: „Sie werden weiter von mir hören.“ Eher einer Drohung glich die Ankündigung des fraktionslosen Dirk Spaniel. Er war vergangenes Jahr aus der AfD aus- und der Werteunion beigetreten. „Wir kommen in die Parlamente in diesem Land. Wir werden gebraucht, und Sie wissen, dass man uns braucht“, trotzte er.
Hin und wieder macht ein Parlamentarier eine politische Forderung zum Schlusswort, die ihm sehr am Herzen liegt. Zum Beispiel die SPD-Abgeordnete Leni Breymaier. Sie setzt sich seit Jahren für ein Sexkaufverbot ein. Ihre letzte Rede beendete sie mit den Worten: „Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir in Deutschland das sogenannte Nordische Modell in der Prostitution einführen sollten.“
Dem politischen Alltag schon weitgehend enthoben präsentierte sich der FDP-Mann Stephan Thomae. Er verabschiedete sich auf Altgriechisch: „Ho bíos brachýs, hē de téchnē makrā, hē de peîra sphalerē, hē de krísis chalepē. – Das Leben ist kurz, die Kunst ist groß, Erfahrungen sind trügerisch und Entscheidungen oft schwierig. Ich danke Ihnen.“
Die letzte Sitzung des Parlaments beendete am Dienstag die Bundestagspräsidentin Bas. Sie klang beinahe so, als fasste sie den Kern der letzten Reden der vergangenen Wochen zusammen. Kollegialität sei einer der entscheidenden Gründe für erfolgreiche parlamentarische Arbeit, sagte Bas. „In diesem Sinne verabschiede ich Sie mit einem fröhlichen Glückauf! Die Sitzung ist geschlossen.“





