Etwa 6,9 Millionen Deutsche haben am Sonntag Parteien gewählt, die es aufgrund der Sperrklausel nicht in den Bundestag schaffen – das BSW und die FDP, aber auch Kleinparteien wie Volt, die ÖDP oder die Piratenpartei. Warum gibt es diese Hürde überhaupt?
Die Fünfprozenthürde soll den Einzug von Splitterparteien in den Bundestag verhindern und die Bildung mehrheitsfähiger Regierungen fördern. Beschlossen wurde sie im Juni 1953 vom Deutschen Bundestag. Eine Reform des Wahlrechts sollte die Stabilität des deutschen Parteiensystems garantieren. Damit zog man Lehren aus der Geschichte der Weimarer Republik. Von 1918 bis 1933 war die Bildung stabiler Regierungen auch durch die reine Anzahl an Parteien im Parlament erschwert worden. Bis zu 14 Parteien waren damals im Reichstag vertreten, darunter auch Kleinstparteien. Die Zersplitterung der Parteienlandschaft wurde für den Aufstieg der NSDAP mitverantwortlich gemacht.
Als erste Partei scheiterte die KPD an der Sperrklausel
Seit der Reform müssen Parteien bei Bundestagswahlen mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erreichen, um in den Bundestag einzuziehen. Von der Sperrklausel ausgenommen sind Parteien nationaler Minderheiten, wie der Südschleswigsche Wählerverband (SSW). Dieser wird im kommenden Parlament wieder mit einem Sitz vertreten sein.
Die erste Partei, der nach der Einführung der Fünfprozenthürde der Einzug in den Bundestag nicht gelang, war die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), die 1956 verboten wurde. Bei der Bundestagswahl von 1953 kam sie lediglich auf 2,2 Prozent, vier Jahre zuvor hatte sie noch 5,7 Prozent erreicht.
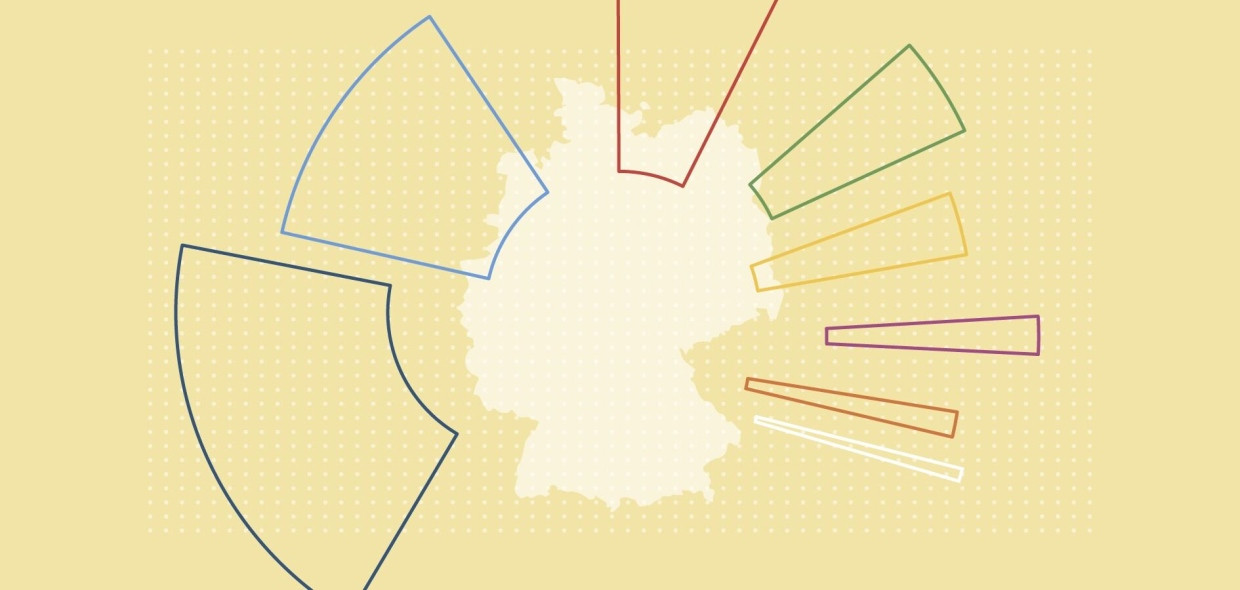
Die rechtsextreme NPD, die mittlerweile unter dem Namen „Die Heimat“ auftritt, schaffte es 1969 mit 4,3 Prozent nur knapp nicht ins Parlament. Später hatte sie keine reelle Chance mehr, in den Bundestag einzuziehen.
Doch auch für Parteien, die sich politisch etablieren konnten, stellte die Fünfprozenthürde immer wieder ein Problem dar. Für die FDP ist es schon das zweite Mal, dass sie den Einzug in den Bundestag verpasst. Trotz einer Zweitstimmenkampagne erreichte sie 2013 unter dem Vorsitz von Rainer Brüderle nur 4,8 Prozent. Noch vier Jahre zuvor hatte sie unter dem damaligen Parteivorsitzenden Guido Westerwelle das beste Ergebnis ihrer Parteigeschichte gefeiert, 14,6 Prozent.
Auch die Linkspartei und ihre Vorgängerparteien mussten immer wieder wegen der Sperrklausel um den Einzug in den Bundestag bangen. 2021 bekam die Linke nur 4,9 Prozent der Zweitstimmen. Dass sie trotzdem ins Parlament einziehen durfte, hatte sie der Grundmandatsklausel zu verdanken. Weil sie in Berlin und Leipzig insgesamt drei Direktmandate gewonnen hatte, konnte sie trotz ihres Scheiterns an der Fünfprozenthürde mit voller Stärke in den Bundestag einziehen.
FDP und BSW mussten lange zittern
Am Sonntag mussten nun FDP und BSW lange bangen, ob ihnen der Sprung über die Fünfprozenthürde noch gelingen würde. Als dies für die Liberalen immer unwahrscheinlicher wurde, kündigte der Spitzenkandidat der FDP, Christian Lindner, seinen Rückzug aus der Parteiführung an.
Das 2024 gegründete BSW verpasste den Einzug in den Bundestag dann so knapp wie keine Partei vor ihr. Mit einem Ergebnis von 4,97 Prozent fehlten ihm nur etwa 13.000 Stimmen. Dass es neu gegründete Parteien nicht auf Anhieb in den Bundestag schaffen, ist nicht ungewöhnlich. Parteichefin Sahra Wagenknecht versuchte deshalb am Montag auch, das Ergebnis als gute Leistung ihrer Partei darzustellen. Das BSW habe im ersten Jahr seiner Parteigeschichte „größere Erfolge erzielt als jemals eine Partei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, sagte sie.
Tatsächlich schafften es etwa die Grünen, die sich im Jahr 1980 als Zusammenschluss von Umwelt- und Antiatomkraftbewegungen gründet hatten, erst auf den zweiten Anlauf ins Parlament. Bei der Bundestagswahl im Gründungsjahr bekam die Partei nur 1,5 Prozent der Zweitstimmen. Erst bei der nächsten Wahl, 1983, schaffte sie mit 5,6 Prozent und 29 Mandaten den Sprung in den Bundestag. Unter den ersten Abgeordneten war auch der spätere Außenminister und Vizekanzler Joschka Fischer.
So wie den Grünen erging es auch der AfD, die seit Sonntag zur zweitgrößten Kraft im Bundestag angewachsen ist. Aus Protest gegen die Eurorettungspolitik gegründet, trat sie 2013 erstmals zur Wahl an. Den Einzug in den Bundestag verpasste sie mit 4,7 Prozent. In den folgenden Jahren radikalisierte sich die Partei immer weiter. Bei der Bundestagswahl 2017 erreichte sie mit 12,6 Prozent dann schon ein zweistelliges Ergebnis und landete damit noch vor FDP, Grünen und Linken.







