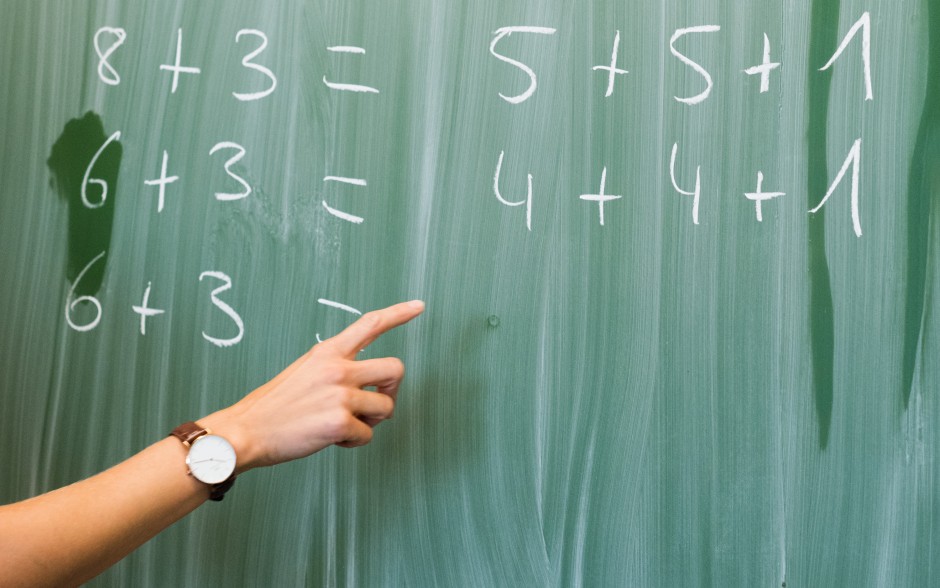
Bei der „Trends in International Mathematics and Science“-Studie (TIMSS) haben die deutschen Viertklässler im Mittelfeld abgeschnitten. In Mathematik erreichen die Schüler einen Wert, der zwar signifikant über dem internationalen Mittelwert liegt, sich aber nicht wesentlich von anderen Staaten in der OECD und EU unterscheidet.
16 Länder erzielen deutlich bessere Mathematikergebnisse als Deutschland. Dazu gehören die asiatischen Staaten Taiwan, Südkorea, Japan, Macau und in der EU Polen, Irland, Lettland und Finnland. Seit 2007 haben sich so gut wie keine Veränderungen bei den Ergebnissen in Mathematik ergeben. Im Jahr 2023 haben an TIMSS 360.000 Viertklässler aus 58 Staaten teilgenommen. Davon sind 22 Staaten und Regionen Mitglieder der EU. 29 Staaten und Regionen gehören der OECD an. Die deutsche Studie wurde von dem Hamburger Bildungsforscher Knut Schwippert geleitet.
Die Risikogruppe der schwächsten Schüler auf den untersten Kompetenzstufen liegt in Deutschland in Mathematik bei 25 Prozent. Diese Kinder verfügen also nur über ein elementares mathematisches Wissen. Sie werden in der Sekundarstufe erhebliche Schwierigkeiten mit Mathematik haben. In asiatischen Staaten wie Taiwan (3,2 Prozent), Südkorea (6,6 Prozent), aber auch in europäischen Ländern wie Litauen (13,5 Prozent), Polen (17,0 Prozent) und Irland (19,1 Prozent) gibt es deutlich weniger Schüler mit so schwachen Leistungen. Insgesamt ist seit 2007 auch der Anteil der schwächsten Schüler gleich geblieben. Allerdings gibt es deutlich mehr Kinder auf Kompetenzstufe I mit rudimentärem schulischem Anfangswissen.
Mehr Schüler mit Spitzenleistungen
Erfreulich ist, dass sich die Spitzengruppe in Mathematik etwas erhöht hat. 8,3 Prozent der Schüler erreichen die höchste Kompetenzstufe, also ein fortgeschrittenes Leistungsniveau. Im Jahr 2007 waren es 5,6 Prozent, 2019 waren es 6 Prozent. Die asiatischen Staaten kommen allerdings auf zweistellige Anteile (Taiwan 40,5 Prozent), Singapur (49,3 Prozent).
Auch der internationale Mittelwert von 10,4 Prozent in der Spitzengruppe, sowie die Vergleichswerte der OECD-Staaten (11,5 Prozent) und EU-Staaten (9,5 Prozent) liegen oberhalb des deutschen Werts. Die gezielte Förderung der Schwächsten und der Stärksten wird den Ländern deshalb vom TIMSS-Konsortium um Schwippert empfohlen. Insgesamt haben die Grundschüler eine positive Einstellung zu Mathematik, im Jahr 2007 war sie allerdings noch ausgeprägter als 2023.
In den Naturwissenschaften (Sachunterricht in der Grundschule) erzielen die deutschen Schüler ebenfalls ein Ergebnis, das zwar signifikant über dem internationalen Mittelwert und etwa auf dem EU-Durchschnitt, aber deutlich unter dem OECD-Durchschnitt liegt. Insgesamt 22 Staaten zeigen deutlich bessere naturwissenschaftliche Leistungen bei ihren Viertklässlern als Deutschland.
Im Vergleich zum Jahr 2007 sind die Leistungen der Viertklässler in Sachkunde schlechter geworden, sie liegen etwa auf dem Niveau des Jahres 2019. Neben der Veränderung des Leistungsniveaus gibt es auch eine breitere Streuung, das heißt die fünf Prozent der Leistungsschwächsten erreichen noch viel niedrigere Kompetenzwerte als in den vorherigen Studienzyklen.
Leistungen von Jungen und Mädchen sind ähnlich
Die Schülerschaft habe sich seit 2007 erheblich verändert, berichten die Autoren. Der Anteil der Kinder mit besonderen Förderbedarfen an Regelschulen hat sich durch die Inklusion deutlich erhöht, außerdem gibt es erheblich mehr Kinder, deren beide Elternteile im Ausland geboren sind. Der Anteil der Kinder ohne Migrationshintergrund ist signifikant gesunken.
Die Leistungen der Jungen und Mädchen in den Naturwissenschaften unterscheiden sich praktisch nicht, weil die Jungen im Vergleich zum Jahr 2019 schlechter geworden sind. Die der Mädchen indessen sind nahezu gleich geblieben.
Kinder aus bildungsaffinen Elternhäusern mit mehr als hundert Büchern zeigen sowohl in Mathematik als auch in den Naturwissenschaften deutlich bessere Leistungen. In den Naturwissenschaften liegt der Leistungsvorsprung sogar bei mehr als einem Lernjahr. Nur in Bulgarien sind die sozial bedingten Disparitäten in den Naturwissenschaften größer als in Deutschland. In Mathematik sind sie in vier Staaten größer. International erzielen Schüler fast durchgehend bessere Leistungen, deren Eltern nicht im Ausland geboren wurden. In Deutschland beträgt der Leistungsvorsprung von Kindern, deren Eltern beide in Deutschland geboren wurden 38 Punkte.
Schüler mit identischen Testleistungen erhalten in Mathematik teilweise sehr unterschiedliche Noten. Sowohl die Schullaufbahnpräferenz der Eltern als auch der Lehrer unterscheiden sich je nach sozioökonomischer Stellung der Familien.
Erschreckend sind die geringen Teilnahmequoten der Lehrer an Fortbildungen. Sie liegen in Mathematik in allen Bereichen bei unter 30 Prozent der Lehrer, im Sachunterricht sogar unter 14 Prozent. An Aufholprogrammen nach der Pandemie hat fast jedes vierte Kind teilgenommen, aber es gibt auch viele Kinder, die keine zusätzliche Förderung bekamen, obwohl bei ihnen das Risiko besteht, dass sich die Lernrückstände anhäufen.
In Mathematik stehen bei TIMSS die Bereiche Arithmetik, Messen und Geometrie und Daten im Fokus, in den Naturwissenschaften Biologie, Physik/Chemie und Geographie. Außerdem werden drei Anforderungsbereiche unterschieden. Es geht um Reproduzieren, Anwenden und Problemlösen. Deutschland beteiligt sich seit 2007 am internationalen Vergleich.







