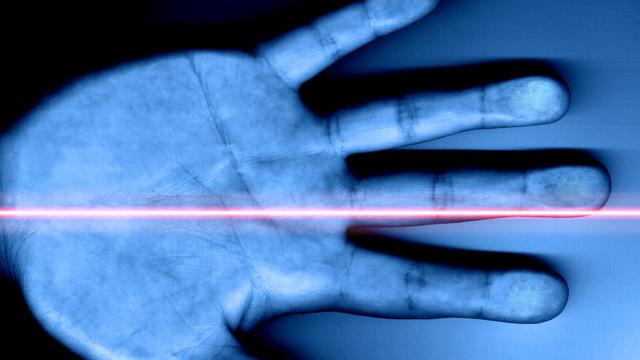
Eine Software, deren Einsatz durch ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts in der Vergangenheit beschränkt wurde, deren Anbieter enge Verbindungen zu US-Geheimdiensten und
Militär pflegen
und die seit vielen Jahren bei Datenschützerinnen und
Bürgerrechtlern in der Kritik steht, sollte es eigentlich schwer haben, in Deutschland neue Kundinnen
und Kunden zu gewinnen. Doch genau eine solche Software wird jetzt vom deutschen Bundesrat hofiert und soll möglichst bald flächendeckend
zum Einsatz kommen.
Wie am Montag
zunächst heise online berichtet hatte, nahm der
Bundesrat vergangene Woche einen
Antrag an, in dem es um die “Priorisierung (…) und
rechtssichere Implementierung eines gemeinsamen Datenhauses für die
Informationsverarbeitung der Polizeien des Bundes und der Länder”
geht. Der Antrag war von den Ländern
Sachsen-Anhalt, Berlin, Hessen und Bayern initiiert worden. Angesichts einer “hohen Gefährdung” der
Sicherheitslage in Deutschland zeichne es sich ab, dass “vorhandene
Informationen über potentielle Straftäter ebenen- und
fachübergreifend besser zusammengeführt werden müssen”.
Um
das zu erreichen, sieht der Antrag den
Betrieb einer bundesweiten Datenanalyseplattform vor, die Daten aus
verschiedenen Quellen zusammenführt und analysiert, um Straftaten
vorzubeugen und aufzuklären. Der Bund soll “den zentralen
Betrieb einer derartigen Interimslösung ermöglichen, wie sie in
Deutschland teilweise schon im Einsatz sind”, heißt es. Obwohl
der Antrag keine Namen nennt, dürfte klar sein, von
welcher Interimslösung die Rede ist.
Es
geht sehr wahrscheinlich um die
Analysesoftware des US-Unternehmens Palantir Technologies, die bereits von
der Polizei in Hessen, Bayern und
Nordrhein-Westfalen eingesetzt wird. Dass
es vielleicht keine gute Idee ist, in
Zeiten transatlantischer Verwerfungen die privaten Daten
deutscher Bürgerinnen und Bürger mit der Analysesoftware eines
umstrittenen Unternehmens aus den USA zu durchleuchten, scheint den Mitgliedern des Bundesrates mehrheitlich nicht bewusst zu sein.
Palantir verspricht “vorhersagende Polizeiarbeit”
Dabei
gibt es seit Jahren Kritik an Palantir und
dessen Software, die unter verschiedenen Namen in Deutschland
kursiert. Offiziell vertreibt das Unternehmen seine Analyseplattform
für Sicherheitsbehörden unter dem Namen Gotham. In Hessen wird sie
unter dem Namen Hessendata eingesetzt, in Bayern ist
von einer “verfahrensübergreifenden Recherche- und
Analyseplattform” (VeRA) die Rede. In NRW heißt das System
“datenbankübergreifende Analyse und Recherche” (DAR). Die
Kosten sollen allein in NRW bei
rund 40 Millionen Euro liegen.
Die Funktionsweise all dieser Plattformen ist ähnlich.
Sie bietet den Kunden, zu denen weltweit
Sicherheitsbehörden, Geheimdienste und das
US-Militär zählen, die Zusammenführung und Analyse von Daten aus verschiedenen
Quellen. Die Polizei könnte an das System etwa den aktuellen
Fahndungsbestand oder offene Fälle andocken sowie weitere
interne, bislang nicht verbundene Datenbanken verknüpfen, etwa
aus der Kfz-Registrierung oder Mobilfunkdaten.
Theoretisch ließen sich auch öffentliche
Quellen, etwa soziale Medien, einspeisen.
Das
Versprechen von Palantir: Die Software kann anhand der Daten
selbstständig Zusammenhänge erkennen, die den Beamtinnen und
Beamten bei einer händischen Suche
womöglich entgehen. So könnten etwa
Straftäter schneller gefunden, mutmaßliche
Gefährder frühzeitig identifiziert und im
besten Fall sogar Anschläge verhindert
werden. Predictive policing,
vorhersagende Polizeiarbeit, heißt dieser Ansatz. Ob das
wirklich funktioniert, ist
umstritten.
Dazu kommt, dass die
Zusammenführung heterogener Datenquellen stets die Gefahr mit sich
bringt, dass die Daten von Unbeteiligten plötzlich in Ermittlungen
einfließen. In der Vergangenheit haben deshalb verschiedene Datenschutz-
und Bürgerrechtsorganisationen gegen den polizeilichen Einsatz von
Palantir geklagt, und das mit Erfolg: Im Februar 2023 hatte das
Bundesverfassungsgericht die damaligen
Regelungen zum Einsatz
solcher Software in Hessen und Hamburg als
verfassungswidrig
erklärt
und gleichzeitig klare Anforderungen formuliert, unter welchen
Bedingungen die Software künftig eingesetzt werden darf. Laut der
Richter bestand ein Grundrechtseingriff “nicht nur in der
weiteren Verwendung vormals getrennter Daten, sondern darüber hinaus
in der Erlangung besonders grundrechtsrelevanten neuen Wissens, das
durch die automatisierte Datenauswertung oder -analyse geschaffen
werden kann”.
Seit
diesem “Palantir-Urteil” sank
das Interesse an der Software des Unternehmens offenbar in
zahlreichen Bundesländern,
und das obwohl die
Unionsfraktion zwischenzeitlich im Bundestag noch
einmal erfolglos für
den Einsatz einer “Bundes-VeRA” plädiert hatte.
In Bayern und Hessen dagegen
ging der Testbetrieb,
womöglich
rechtswidrig,
munter weiter
und es ist vielleicht
kein Zufall, dass beide
Länder nun erneut
den Einsatz von Palantir im Bund über den Umweg des Bundesrates
lancieren.







