So versteckt äußert sich die aktuelle Administration ja nicht. Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz ähnliche Worte gebraucht. Von Trump hören wir das schon länger. Insofern ist es nicht sehr überraschend, wenn auch hinter verschlossenen Türen so gesprochen wird.
Roter Faden würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es zieht sich seit dem Irakkrieg von 2002 und 2003 durch, dass vor allem republikanische Regierungen die Europäer für Schwächlinge halten und sie härter als die Demokraten dafür angehen, dass sie die Trittbrettfahrer der Sicherheitsallianz sind. Es sind harte Worte, die Vance und Hegseth gebrauchen. Aber im Kern haben sie recht.
Wenn die Amerikaner mit den Europäern schon länger unzufrieden sind, warum haben die bisherigen Regierungen nie den Beistand in der NATO infrage gestellt?
Der Beistand in der NATO ist für beide Seiten von Vorteil. Und das ist etwas, was Trump nicht versteht. Natürlich profitieren die Europäer vom Nuklearschirm der Amerikaner und davon, dass sie ihre Verteidigungsausgaben zurückfahren konnten, weil sie glaubten, die Amerikaner wären im Ernstfall zur Stelle. Gleichzeitig haben auch die Amerikaner Vorteile. Sie führen die größte Allianz auf dem Planeten an, mit mittlerweile 31 Bündnispartnern. Europa ist eine zentrale geopolitische Region nicht nur bei der Eindämmung Russlands, sondern auch auf dem Weg in den Nahen Osten und nach Afrika. Nicht umsonst ist das größte Militärkrankenhaus der Welt außerhalb der USA in Deutschland. Nicht umsonst ist der größte Truppenübungsplatz außerhalb der USA in Deutschland. Aber das zu sehen, erfordert mehr strategische Weitsicht, als sie im Moment im Weißen Haus angesiedelt ist.
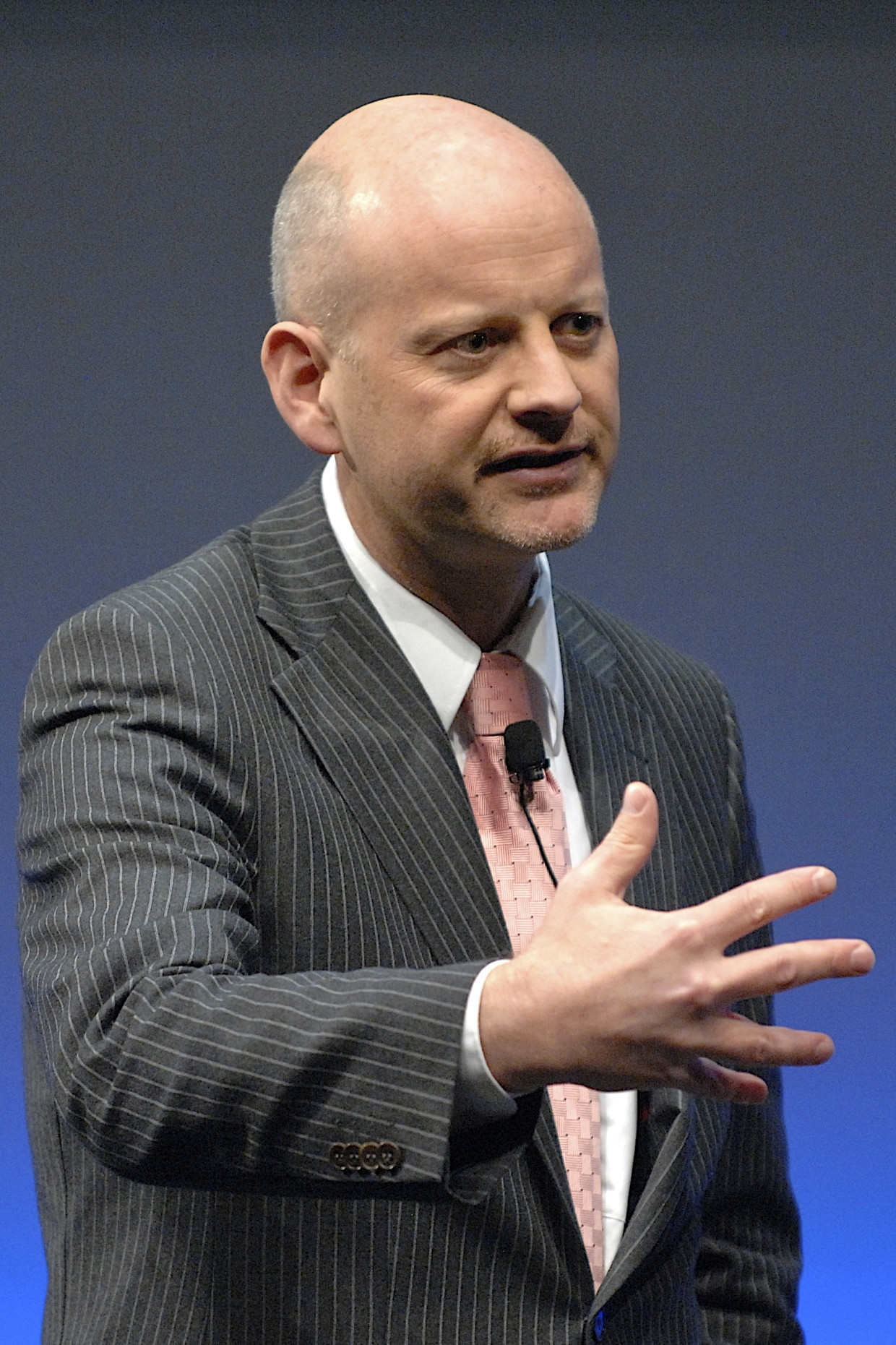
Was müssten die Europäer Ihrer Meinung nach tun, um den Amerikanern deutlich zu machen, dass eine Zusammenarbeit im eigenen Interesse wäre?
Ich glaube, dafür ist es schon fast zu spät. Trump ist in seiner Radikalität bereit, die über 70 Jahre von den USA gepflegten Allianzstrukturen zu vernichten. Das ist eigentlich nicht mehr zu retten mit all dem Aufwand, den im Moment vor allem die Briten und manche osteuropäische Staaten an den Tag legen. Vielleicht hätte man was retten können, wenn Europa nach der ersten Invasion Russlands in der Ukraine 2014 wirklich mehr Lasten übernommen hätte. Die Europäer als verteidigungsfähiger und belastbarer Bündnispartner, das wollte Obama, das wollte Biden und zum Teil selbst Trump in seiner ersten Regierungszeit. Da haben wir völlig versagt, und am meisten versagt haben die Deutschen in ihrem Vulgärpazifismus. Die aktuelle Trump-Administration zumindest im Boot zu halten, erscheint mir auf der einen Seite absolut notwendig, auf der anderen Seite fast unmöglich.
Sie sagen, selbst in der ersten Amtszeit von Trump habe es noch den Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit den Europäern gegeben. Warum ist das nicht mehr so?
In seiner ersten Amtszeit hatte Trump kaum eigene Leute und musste auf etablierte Republikaner zurückgreifen. Denken Sie etwa an den Verteidigungsminister Mattis, an den Sicherheitsberater McMaster und an General Kelly als Stabschef. Die haben Trump im sicherheitspolitischen Bereich eingenordet. Das hat er ihnen nie vergeben. Trump konnte in seiner ersten Amtszeit nie Trump sein. Jetzt erleben wir einen erfahreneren, einen entschlossenen, einen skrupelloseren und einen bösartigeren Trump, als wir ihn je gesehen haben. Und wir erleben einen Trump, der Außenseiter wie Hegseth und die Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard nach oben spült. Sie sind abhängig von Trumps Wohlwollen und setzen genau das um, was er sich in seinen Kopf gesetzt hat. Dazu gehören Vergeltungsphantasien gegenüber Europäern, die Trump in der ersten Amtszeit immer wieder geschmäht haben, die sich über seinen Politikstil lächerlich gemacht haben und die seine Wahlniederlage 2020 gefeiert haben. Jetzt ist für Trump die Payback-Zeit, die Zeit des Heimzahlens. Es geht nicht um langfristige Strategie, sondern um Rache.
Gleichzeitig ist „America First“ keine Erfindung Trumps. Wie hat sich im Zweiten Weltkrieg ein Franklin D. Roosevelt mit dem amerikanischen Kriegseintritt gegen jene durchgesetzt, die nicht gegen Hitler kämpfen wollten?
In der Tat, „America First“ hat damals Charles Lindbergh aufgebracht. Es gab eine große isolationistische Stimmung im Kongress und vor allem in der republikanischen, aber auch in der demokratischen Partei. Was den Unterschied gemacht hat, war der japanische Überfall auf Pearl Harbor, der quasi innerhalb von Minuten den ganzen Isolationismus weggeblasen hat. Heute, und das ist kurios, haben wir in den USA eine stärker proeuropäische und proukrainische Stimmung, als es auf den ersten Blick scheint. Die Demokraten sind mit wenigen Ausnahmen proeuropäisch. Aber auch viele republikanische Abgeordnete sind es. Sie trauen sich nur nicht, den Kopf rauszustrecken, weil Trump ihnen den sofort abhacken würde. Die Transatlantiker, von denen ich ausgehe, dass sie im Kongress, in der Bürokratie und in der Öffentlichkeit nach wie vor die Mehrheit stellen, sind den Rachephantasien von Donald Trump ausgeliefert.
Nein, die Sowjetunion war immer Feind Nummer eins. Man hat zwar immer wieder versucht, die Europäer zu mehr Verteidigungsleistungen zu animieren. Es gab die große Debatte um das Burden-Sharing, die Lastenteilung. Man hatte auch Zwiste mit den Europäern. So war es 1956, als die Briten und die Franzosen im Suezkanal auf einmal militärisch aktiv wurden und die Amerikaner die ganze Aktion mehr oder weniger abbliesen. Das waren tiefe Verwerfungen, aber die europäisch-amerikanische Zusammenarbeit war nie grundsätzlich infrage gestanden. Warum? Weil alle Präsidenten vor Trump verstanden haben, dass auch die Amerikaner enorm davon profitieren. Heute will Trump China als Hauptantipoden der USA einhegen. Wie das ohne die Kooperation der Europäer gelingen soll, gerade im Ökonomischen, ist völlig schleierhaft. Im Moment isolieren sich die Amerikaner von ihren wichtigsten Bündnispartnern und überlassen den Chinesen und den Russen das Feld. Das ist ein strategischer Wahnsinn, wie wir ihn in den letzten 80 Jahren in der Weltpolitik nicht mehr erlebt haben.
Um auf die Signal-Enthüllung zurückzukommen: Vance und Hegseth schimpften auf die Europäer, halfen ihrer Versorgungssicherheit durch den Schlag gegen die Huthi aber doch. Warum?
Es gibt natürlich mehrere Prioritäten in der amerikanischen Politik. Die Freiheit der Schifffahrt gehört auch dazu. Eine Priorität ist im Moment auch, Druck auf Iran und seine Verbündeten auszuüben. Nach den Schlägen gegen die Hizbullah, die Hamas und Assad sind die Huthi die Letzten, die noch Widerstand leisten können. Das Motiv der Stärke ging ja auch aus den Äußerungen auf Signal hervor. Wir dürfen es nicht so machen wie der schwache Biden. Die Botschaft ist: Wir müssen Handlungsfähigkeit und Stärke demonstrieren.
Könnte dieses Bedürfnis, Stärke zu zeigen, am Ende sogar stärker sein als der Rückzug im Sinne von „America First“?
Das ist schwer vorherzusehen. Meines Erachtens schlagen ins Trumps Körper zwei Herzen. Zum einen will er Amerika stärken, indem man sich völlig auf Innenpolitik konzentriert und Truppen auch zurückholt. Doch er will Stärke auch international beweisen. Schon in seiner ersten Amtszeit hat Trump die Flugfelder von Assad, als der Giftgas einsetzte, bombardieren lassen und ist da viel weiter gegangen als Obama. Aber es ist nicht mehr wirklich Strategie. Es ist für Beobachter wie Sie im Journalismus und für mich in der Wissenschaft fast schon mit Verzweiflung zu betrachten, dass amerikanische Politik im Grunde fast nur noch aus dem Bauch, und zwar aus Trumps Bauch heraus gemacht wird.







