Drei Investitionsbereiche des PIF haben wir genauer beleuchtet. Klicken Sie auf eines der Symbole um zu den entsprechenden Texten zu springen.


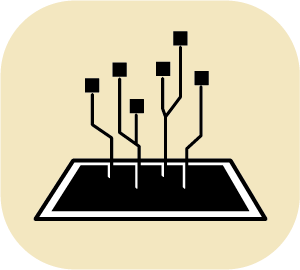
Sebastian Sons, Experte von der Denkfabrik Carpo, spricht von zwei Phasen, die Muhammad Bin Salmans Reformprojekt und auch die Art und Weise durchlaufen hätten, in welcher der PIF investiert. Eine erste Phase habe von der Implementierung der „Vision 2030“ in den Jahren 2016 und 2017 bis zu den Jahren 2021 und 2022 gedauert. „In dieser Zeit hat man sich sehr stark auf die Leuchtturmprojekte wie Neom konzentriert, um eine Begeisterung herzustellen und der eigenen Bevölkerung, vor allem dem Ausland zu zeigen: Hier passiert etwas. Ihr müsst nach Saudi-Arabien kommen und investieren.“
Tatsächlich sei es gelungen, die „Vision 2030“ als Marke zu etablieren, ebenso eine Erzählung im Inneren, nach der das Land und seine Bewohner modern sind und sportlich und innovativ sein sollen, sagt Sons. Jetzt, in der zweiten Phase, gehe es darum, die sehr ambitionierten Vorhaben der Realität anzupassen.
Diese neue Realität ist vor allem durch den gesunkenen Ölpreis und zunehmenden finanziellen Druck geprägt. Noch immer kommen die Mittel des PIF zu einem überbordenden Teil aus den Öleinnahmen. Laut Einschätzung von Wirtschaftsfachleuten brauchte es einen Ölpreis von etwa 100 Dollar pro Barrel, um das Niveau seiner Investitionen in die Wirtschaftsdiversifizierung halten zu können. Derzeit liegt er bei etwa 60 Dollar. Branchendienste melden deutliche Investitionsrückgänge in diesem Jahr.
Der PIF gab seine Milliarden lange Zeit allerdings eher nach dem Gießkannenprinzip aus. Saudi-Arabien war ein Eldorado für Beratungsunternehmen, die lukrative Verträge machten. Jamal Khashoggi, ein Kritiker des Kronprinzen, der 2018 von einem saudischen Greiftrupp ermordete wurde, spottete seinerzeit, ein „Zeitalter der Berater“ sei angebrochen. Jetzt ist das Königreich dazu gezwungen, sein Geld vorsichtiger und umsichtiger zu investieren.
Die Anpassung, von der Sons spricht, besteht laut Angaben mehrerer Experten und Insider vor allem darin, die Investitionen in die Leuchtturmprojekte zurückzufahren, die auch weniger ausländische Investoren angelockt haben, als erwartet worden war. Deren Umsetzung wird verlangsamt, wo es möglich ist. Schon im vergangenen Jahr berichtete ein Wirtschaftsberater auf einer Investorenkonferenz, auch im Falle des Prestigeprojektes Neom habe die Führung die Bremse gezogen. In manchen Fällen ist das unmöglich, weil es Fristen gibt: die Infrastruktur für die Asiatischen Winterspiele 2029, die Expo 2030 und die Fußballweltmeisterschaft 2034. Dafür müssen unter anderem Stadien gebaut werden und ein Skigebiet aus Kunstschnee.
Grundsätzlich soll der PIF nun in andere Felder investieren, die der Führung in Riad derzeit wichtiger erscheinen: Infrastruktur, bezahlbarer Wohnraum, Bildung, Energie, Schaffung neuer Wirtschaftszweige im Land. Anders als Golfstaaten wie Qatar oder die Vereinigten Arabischen Emirate hat Saudi-Arabien eine große Bevölkerung, die zwar einen größeren Binnenmarkt bringt, die aber nicht durchgehend wohlhabend ist. Auch auf deren Bedürfnisse muss der PIF seine Investitionen einstellen. Die neue Metro in Riad wird zum Beispiel von den Einwohnern dankbar angenommen. „Nicht alle Saudis haben am Ende des Tages auch wirklich das Geld, die neuen Unterhaltungsangebote regelmäßig zu nutzen. Da gibt es einen Sättigungsprozess“, sagt Sebastian Sons. Das sei auch ein Grund dafür, dass der PIF Felder wie den E-Sport und Gaming erschließt.
Und der Staatsfonds hat im Zuge des Evaluierungsprozesses auch die Qualitätskontrolle der Investitionen verstärkt. „Der PIF achtet jetzt tatsächlich sehr viel stärker darauf, dass seine Projekte wirtschaftlich überlebensfähig sind und die Wirtschaft ankurbeln“, sagt ein Insider mit Kontakten in die saudische Führung. Diese Bemühungen zeigten auch schon Erfolge. „Sie sind gut darin, aber sie könnten es natürlich noch besser machen.“
An fähigem Personal mangelt es nicht. Die saudische Führung sorgt dafür, dass in den Chefetagen wichtiger Unternehmen fähige Spitzenkräfte sitzen, häufig aus dem Ausland. Zugleich sichert sie sich Einfluss, etwa durch Mitglieder der Königsfamilie oder Regierungsmitarbeiter in den Vorständen und Aufsichtsräten.
PIF-Gouverneur Yasir al-Rumayyan ist nicht nur einer der einflussreichsten Männer in Saudi-Arabien. Er gilt auch als erfahrener, pragmatischer, intelligenter und scharfsinniger Manager mit exzellenten Kontakten in die Finanzwelt. Der Banker, der einen Abschluss von der Harvard Business School hat, wird als effektiver, weltreisender Wirtschaftsdiplomat des Königreiches beschrieben. „Rumayyan ist so etwas wie der Inbegriff des saudischen Wirtschaftsmodells: jemand, der aus der Privatwirtschaft kommt, der aber sehr, sehr stark in der staatlichen Wirtschaft engagiert ist“, sagt Carpo-Experte Sebastian Sons.
Präsident Donald Trump und PIF-Gouverneur Yasir al-RumayyanAP
Rumayyan ist in der Führung des saudischen Ölkonzerns Aramco vertreten sowie in einigen anderen Führungsetagen anderer wichtiger Unternehmen, in die der PIF investiert hat. Rumayyan ist außerdem Vorsitzender des britischen Fußballvereins Newcastle United. Den Einstieg des PIF in den Klub hatte er maßgeblich orchestriert. Überhaupt hat er einen maßgeblichen Fußabdruck in den PIF-Sportinvestitionen, einem wichtigen Feld der Aktivitäten des Staatsfonds.
Vor allem aber genießt Rumayyan, der nicht zur Königsfamilie gehört, das Vertrauen des faktischen Herrschers Muhammad Bin Salman, dessen Macht sich auch auf den PIF erstreckt. Der Kronprinz gebietet auch über die saudische Investitionspolitik, die unter seiner Regie in den Händen des PIF zentralisiert worden ist. Muhammad Bin Salman ist sein Aufsichtsratsvorsitzender. Mit den wichtigen Entscheidungen des PIF dürfte es sich ebenso verhalten wie mit denen des saudischen Staates: Das letzte Wort hat der mächtige Kronprinz.
Dass sein autoritärer und machtbewusster Führungsstil hilfreich ist, eine zukunftsfähige innovative Wirtschaft zu errichten, wird von Experten bezweifelt. Dazu brauche es eine Umgebung, in der kritisches Denken ebenso möglich sei wie kritische Meinungsäußerungen. Die Führung in Riad reagiert sehr empfindlich auf Wirtschaftsberichterstattung, die Zweifel am Gelingen der Reformen weckt. Gut informierte Gesprächspartner in Riad kritisieren, die saudische Führung sei nicht besonders gut darin, die Neuausrichtung der Investitionen oder die wirtschaftlichen Härten, die der sparsamere Kurs mit sich bringe, der Öffentlichkeit zu erklären.
Muhammad Bin Salman selbst ist berüchtigt dafür, dass er mit harter Hand gegen jene vorgeht, die seine Autorität infrage stellen. In Fragen der Wirtschaftsdiversifizierung sei er sich aber durchaus darüber im Klaren, dass es nicht hilfreich ist, wenn eingeschüchtertes Spitzenpersonal seine Entscheidungen nach seiner Meinung ausrichtet, heißt es von Insidern. Ausschüsse, die in wichtigen Fragen tagten, kämen daher oft erst einmal ohne ihn zusammen.

Von Ronaldo bis Formel 1: Das Königreich greift im Sport an – auf vielen Ebenen
Beim Fußball waren die Nachbarn früher dran: Schon im Jahr 2008 übernahm mit Scheich Mansour bin Zayed Al Beim Fußball waren die Nachbarn früher dran: Schon im Jahr 2008 übernahm mit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan ein Mitglied der Herrscherfamilie Abu Dhabis den Premier-League-Klub Manchester City. Bei Paris St.-Germain wiederum stieg 2011 Qatar ein und investierte ebenfalls Hunderte Millionen Euro. Die beiden Spitzenklubs sind die prominentesten Beispiele für das Engagement von Ländern aus der Golfregion im europäischen Fußball. Saudi-Arabien mischt hier seit Oktober 2021 mit, damals erwarb der PIF 80 Prozent der Anteile an Newcastle United.
Im Unterschied zu den Nachbarn verfolgt Saudi-Arabien eine zweigleisige Fußball-Strategie. Mit Ablösesummen und Gehältern, die selbst jene der ausgabefreudigen – und von Investoren unterschiedlichster Couleur finanzierten – Premier-League-Klubs übertrafen, lockte man in den vergangenen Jahren diverse Stars aus Europa in die heimische „Pro League“. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Fabinho spielen beispielsweise für saudische Teams. Auch Neymar lief zeitweise für Al-Hilal auf, einen der vier Vereine, die im Besitz des PIF sind. Die anderen sind Al-Ittihad, Al-Ahli und Al-Nassr – Ronaldos Klub. 2034 wird dann die Fußball-WM im Land stattfinden.
Sport ist ein zentraler Part der „Vision 2030“ von Kronprinz Muhammad Bin Salman – doch es geht längst nicht nur um Fußball. So steht Saudi-Arabien nicht zuletzt hinter der Golf-Tour LIV, mischt in der Tennis-Welt mit, trägt große Kampfsport-Events im Land aus oder wird im Jahr 2029 die asiatischen Winterspiele veranstalten. Austragungsort soll ein Teil der futuristischen Planstadt Neom sein – ein weiteres Großprojekt des Kronprinzen. Noch vergleichsweise frisch ist der Einsteig des PIF am Streamingdienst DAZN. Für die Minderheitsbeteiligung soll rund eine Milliarde Dollar geflossen sein, auch der Aufbau eines Gemeinschaftsunternehmens zur Übertragung von saudischen Sport-Events ist vorgesehen. Die Pro League etwa zeigt DAZN in Deutschland schon.
Der kanadische Aston-Martin-Fahrer, Lance Stroll, während des Trainings in Dschidda.AP
Formel 1 läuft hierzulande beim Konkurrenten Sky, aber auch hier soll Saudi-Arabien nach dem Willen der Verantwortlichen im Königreich präsenter werden. Es ist kein Geheimnis, dass man mit dem Einstieg bei einem Team oder gleich der Übernahme liebäugelt. Das Interesse angesichts des globalen Wachstums der Rennserie unterstrich ein Mitglied der Herrscherfamilie kürzlich vor dem Grand Prix in der saudischen Hafenstadt Dschidda. Seit 2021 wird hier gefahren, zudem ist der staatliche Ölkonzern Aramco einer der Hauptsponsoren der Serie und Partner des Aston-Martin-Rennstalls – oder wie er offiziell heißt: „Aston Martin Aramco Formula One Team“.
In der Königsklasse des Motorsports waren zwei Nachbarstaaten übrigens ebenfalls schneller. In Bahrain fährt die Formel 1 seit 2004, Abu Dhabi wurde 2009 in den Kalender aufgenommen. Und auch zwei Staatsfonds sind schon involviert: Bahrains Vehikel ist Mehrheitseigentümer von Spitzenreiter McLaren Racing, und der qatarische hält ein Drittel der Anteile am künftigen Audi-Team.

Die Wüste spielt: Saudi-Arabien ist wichtigster Investor im E-Sport
Während andere Länder sich lieber mit den durchaus existierenden negativen Seiten von Videospielen befassen – Gewaltdarstellung, Sucht, Bewegungsmangel, Glücksspielelemente, verbraucherschädliche Monetarisierungsmodelle –, geht Saudi-Arabien einen anderen Weg: Seit 2022 hat das Land eine eigene Investitions- und Entwicklungsstrategie für Gaming und E-Sport. Vom 178 Milliarden Dollar großen Umsatzkuchen der globalen Branche will sich das Königreich sein Stück sichern.
Dazu plant das Land, bis 2030 etwa 37,9 Milliarden Dollar dafür auszugeben, Saudi-Arabien zu einem Schwergewicht der Branche zu machen. Am Ende sollen so 39.000 Arbeitsplätze entstehen und das Bruttoinlandsprodukt direkt und indirekt um 13 Milliarden Dollar aufbessern. Im Zentrum der Strategie steht das Unternehmen Savvy Games Group. Der saudische Staatsfonds (PIF) nutzt Savvy Games einerseits als Dachmarke für neu gegründete und zugekaufte Unternehmen aus dem Gaming- und E-Sport-Bereich. Andererseits dient es auch als Beteiligungsunternehmen, das an der Börse in internationale Spieleunternehmen investiert.
Im E-Sport ist Saudi-Arabien mittlerweile der wichtigste Investor und Veranstalter von Turnieren. 2022 kaufte Savvy Games die beiden wichtigsten E-Sport-Organisationen, schloss sie zur ESL Faceit Group zusammen und bescheinigt sich damit laut Geschäftsbericht 2023 einen globalen Marktanteil von 40 Prozent in diesem Bereich. Nicht nur richtet das Land unter der Aufsicht des deutschen Funktionärs Ralf Reichert den E-Sports World Cup aus, der in diesem Jahr mit 70 Millionen Dollar Preisgeldern Spieler aus aller Welt locken soll. Auch gelang es dem saudischen olympischen Komitee, sein internationales Pendant davon zu überzeugen, 2027 die ersten Olympischen E-Sport-Spiele im Königreich abzuhalten.
Nicht jeder ist mit Saudi-Arabiens Vorreiterrolle glücklich. Aufgrund der schwierigen Menschenrechtslage im Land haben sich vereinzelt Spieler, zum Beispiel der finnische „Overwatch“-Spieler Petja „Masaa“ Kantanen, aus Protest von Veranstaltungen in Saudi-Arabien abgemeldet. Eine Person nahe am Geschehen der Branche sagte der F.A.Z. am Rande eines Interviews zum Thema, dass man zwar offen für solche Diskussionen sei, aber wenn andere Länder keine Finanzmittel für E-Sports aufwenden wollten, „dann übernehmen es halt die Saudis“.
Aufseiten der Spieleproduktion macht Savvy Games noch wenig mit Eigenproduktionen von sich reden. Dafür meldet das Unternehmen fast am laufenden Band hochkarätige Zukäufe. 2023 etwa kaufte Savvy Games für 4,3 Milliarden Dollar den Handyspiel-Verleger Scopely. Laut Zahlen des Datenanbieters Sensor Towers war Scopely 2024 nach Umsatzzahlen mit rund 2,6 Milliarden Dollar der global zweitgrößte Verleger auf diesem Markt. Nachdem Scopely seit Kurzem auch der Spielehit „Pokémon Go“ gehört, dürften sie diese Position leicht verteidigen können.
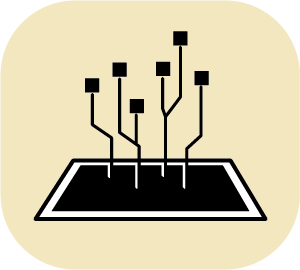
100 Milliarden Dollar für KI: Riad setzt auf Spitzenforscher und Big Tech
Der deutsche Forscher Jürgen Schmidhuber gilt als einer der Urväter der Künstlichen Intelligenz (KI). Bis 1995 lehrte er an der TU München. Inzwischen arbeitet Schmidhuber aber weder für amerikanische Eliteunis wie Stanford oder das MIT noch für eine deutsche Universität. Stattdessen leitet der renommierte Fachmann seit 2021 die KI-Initiative der saudischen „King Abdullah University of Science and Technology“ (KAUST). „Seit dem Jahr 2016 ist die KAUST die Universität mit den weltweit meisten Zitaten pro Professor, noch vor den üblichen Verdächtigen wie zum Beispiel Princeton“, erklärte Schmidhuber 2021 der F.A.Z. seinen Gang nach Saudi-Arabien. „Ihre finanzielle Ausstattung lässt sich nur vergleichen mit der von Harvard und Yale, die allerdings weit größer sind.“ Schmidhuber schwärmte von „enormen Ressourcen, um sowohl die grundlegende als auch die angewandte KI-Forschung voranzutreiben“.
Daran hat sich bis heute wenig geändert. Künstliche Intelligenz ist eine der Säulen in Riads „Vision 2030“, um die Abhängigkeit vom Öl zu verringern. Der Manager des saudischen Investmentfonds Yasir al-Rumayyan sieht Riad mittelfristig nicht nur als ein regionales Zentrum für Künstliche Intelligenz, ihm schwebt ein KI-Standort von globaler Bedeutung vor. Im November vergangenen Jahres berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Saudi-Arabien im Rahmen des „Project Transcendence“ 100 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz investieren wolle. Mit dem Geld sollen Rechenzentren und Start-ups aufgebaut und KI-Fachleute und Tech-Unternehmen angelockt werden.
Das scheint zu fruchten: Der saudische Staatsfonds hat eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud für ein KI-Zentrum unterzeichnet, in das zwischen fünf und zehn Milliarden Dollar fließen sollen. Das Geld soll auch für die Entwicklung von KI-Modellen in arabischer Sprache verwendet werden. Microsoft und Amazons Cloud-Sparte AWS bauen gerade ihre Rechenzentrenkapazitäten in der Region aus. 2026 will Amazon die ersten Rechenzentren in Saudi-Arabien eröffnen; weitere 5,3 Milliarden Dollar Investitionen sind geplant. Auch der Rechenzentrenbetreiber Equinix will für mehr als eine Milliarde Dollar ein großes Rechenzentrum in Saudi-Arabien bauen. Im April gab Microsoft bekannt, 1,5 Milliarden US-Dollar in das arabische KI-Unternehmen G42 mit Sitz in Abu Dhabi zu investieren.
Saudi-Arabien konkurriert in seinen KI-Bemühungen auch mit seinen Nachbarländern, nicht zuletzt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Abu Dhabi finanziert beispielsweise die Investmentgesellschaft MGX, um international in KI-Projekte zu investieren. MGX ist unter anderem am amerikanischen Projekt Stargate beteiligt, einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem ChatGPT-Entwickler Open AI, Softbank und Oracle, das für 500 Milliarden Dollar KI-Infrastruktur aufbauen soll. Auch in Frankreichs und Italiens KI-Infrastruktur investiert MGX.







