Selten sind sich Öffentlichkeit und Expertenschaft so uneinig wie bei der Mietpreisbremse. Unter Ökonomen gilt die gesetzliche Regulierung der Mieten als eines der schlechtesten Mittel, um Mieten gering zu halten. Der Sachverständigenrat der sogenannten Wirtschaftsweisen sprach sich in seinem jüngsten Jahresgutachten gegen eine Verlängerung über das Jahr 2024 hinaus aus. Nur 14 der 38 Mitglieder der Industrieländerorganisation OECD haben eine ähnliche Regelung.
Die Bevölkerung in Deutschland aber ist dafür. Vor der Einführung im Jahr 2014 sprachen sich drei Viertel der Deutschen für das Gesetz aus. Inzwischen ist zwar die Ernüchterung gewachsen. Nur rund die Hälfte der Deutschen schätzt die Bremse noch. Doch die mangelnde Zustimmung dürfte auch damit zu tun haben, dass die Mietpreisbremse vielen als zu locker gilt – und nicht etwa als komplett verfehlt. Die neue Bundesregierung jedenfalls will das Gesetz noch einmal verlängern.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Was verrät das über das Verhältnis von Fachleuten einerseits und Durchschnittsbürgern andererseits? Erinnern wir uns: In Großbritannien stimmte die Bevölkerung gegen den Rat von Ökonomen für den Brexit. In den Vereinigten Staaten wählte sie Donald Trump ins Präsidentenamt, damit dieser – ebenfalls gegen den Rat von Experten – Zölle erhebt. In Deutschland ist das Bild uneinheitlich. Die Debatten über den Klimawandel und die Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass in Umfragen mehr Leute als früher Vertrauen in die Wissenschaft äußern. Aber auch die Zahl derjenigen, die von Misstrauen sprechen, ist gewachsen.
Mehrheit der Ökonomen lehnt Mietkontrollen ab
Nun hat ein Team von Ifo-Institut und Universität Salzburg untersucht, wie es speziell bei den Mietkontrollen zur Kluft zwischen Öffentlichkeit und Experten kam; die Ergebnisse wurden gerade in der Fachzeitschrift „Economica“ veröffentlicht. „Wir wollten verstehen, warum Öffentlichkeit und Wissenschaftler so weit auseinanderliegen“, sagt Studien-Mitautor Mathias Dolls.
Warum die meisten Ökonomen Mietkontrollen ablehnen, ist klar. Erstens können solche Kontrollen den Wohnungsmangel, der die Preise nach oben treibt, noch verschärfen. Wenn die Mieten künstlich niedrig gehalten werden, dann lohnt es sich für die Vermieter weniger, neue Wohnungen zu bauen und alte zu sanieren. Die Konkurrenz der Mieter äußert sich dann zwar nicht mehr in steigenden Mieten, aber in langen Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen. Vermieter picken sich dann oft diejenigen Mieter heraus, die in allen Belangen den geringsten Ärger versprechen. Zugespitzt: Kinderlose, doppelverdienende Beamtenpaare mit weißer Hautfarbe haben dann beste Chancen, für andere wird es schwieriger.
Zweitens bemängeln die Wirtschaftswissenschaftler, dass die Wohnungen wegen der Mietpreiskontrolle auf Mieterseite tendenziell falsch verteilt werden. Mancher leistet sich dann Wohnraum, den er gar nicht braucht. Singles leben in riesigen Wohnungen, in denen ganze Familien unterkommen könnten. In Berlin gibt es sogar Leute, die längst weggezogen sind, aber ihren Mietvertrag behalten – weil sie das nicht viel mehr kostet als eine gelegentliche Nacht im Hotel.
So weit, so klar. Aber warum finden so viele Leute die Mietkontrollen trotzdem gut? Haben sie schlicht keine Ahnung von den Erkenntnissen der Fachleute? Oder haben sie durchaus gute Gründe für ihre Position, die von den Experten nur nicht berücksichtigt werden?
Zwei wichtige Argumente
Dazu hat Mathias Dolls mit seinen Ökonomen-Kollegen Paul Schüle und Lisa Windsteiger rund 18.000 Menschen in Deutschland befragt. Als in Berlin noch der härtere Mietendeckel galt, fragten die Forscher die Menschen, wie gut sie das fanden, und legten ihnen gemeinsam mit dieser Frage verschiedene Informationen über den Mietendeckel vor. So konnten sie feststellen, welcher Aspekt der Debatte den Leuten wichtig war. Ging es ihnen vor allem um die großen Immobilienkonzerne? Um den Reichtum der Vermieter? Oder um sozialen Wohnungsbau?
Von den verschiedenen Fakten über den Immobilienmarkt, die den Befragten vorgelegt wurden, erwiesen sich zwei als besonders wichtig. Einerseits die Erinnerung daran, dass Mietkontrollen dazu führen, dass weniger Wohnungen gebaut werden. Wenn die Forscher das erwähnten, verlor der Mietendeckel an Beliebtheit. Relevant war andererseits die Erkenntnis, dass Mietobergrenzen helfen, alteingesessene Bewohner im Viertel zu halten, auch wenn diese nicht viel Geld verdienen. Wenn die Forscher darüber sprachen, wuchs die Zustimmung.
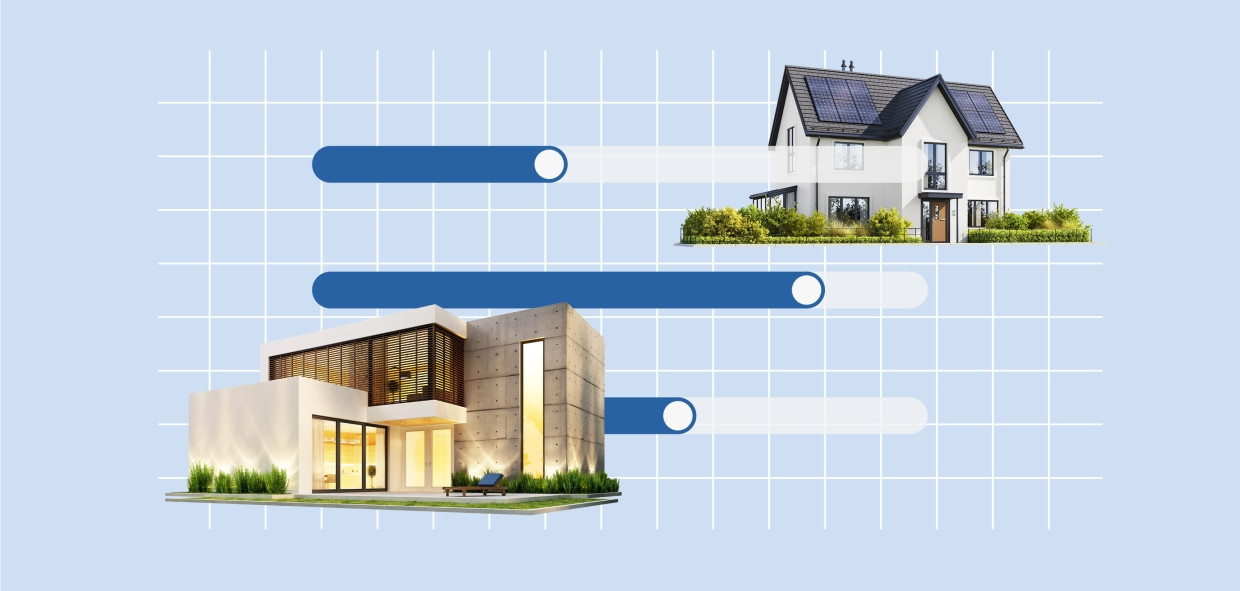
Allerdings galt auch: Jede einzelne dieser Informationen überzeugte vor allem diejenigen Leute, die einen Mietendeckel sowieso schon gut oder schlecht fanden. Sie wurden durch die Information quasi an ihre Grundposition erinnert und in ihrer Ansicht bestärkt. Dass sich jemand von einem Argument für die andere Seite überzeugen ließ, kam nur selten vor. Auch diejenigen, die sich vor dem Experiment über Fakten getäuscht hatten, ließen sich von den neuen Informationen praktisch nicht umstimmen. Solche Versuche bezeichnen die Wissenschaftler selbst als „nicht erfolgreich“.
Differenzierte Sicht auf Wertentscheidungen
Was sagt das über die öffentliche Debatte? „Unsere Ergebnisse decken Herausforderungen für Informationen und politische Kommunikation auf“, formulieren die Forscher. Man kann es deutlicher sagen: Die Studie lässt den Eindruck zu, dass Trumps Unterstützer einer tieferen Wahrheit auf der Spur sein könnten, wenn sie Falschangaben als „alternative Fakten“ bezeichnen – weil echte Fakten nur einen begrenzten Einfluss auf die Meinungsbildung zu haben scheinen.
Die Wissenschaftler plädieren dafür, die Gräben zwischen unterschiedlichen Weltanschauungen zu unterlaufen und gleichzeitig verschiedene Perspektiven auf ein Thema im Blick zu behalten, auch wenn diese einander widersprechen. Ihre Studie lässt sich allerdings auch anders interpretieren. Wenn die Bevölkerung sich von der geballten Kompetenz der Wissenschaft nicht überzeugen lässt, liegt es vielleicht nicht nur daran, dass sie schlecht informiert ist. Es könnte auch damit zu tun haben, dass sich die Bewertungsmaßstäbe unterscheiden. Manchen Bürgern dürften niedrige Mieten für Alteingesessene schlicht wichtiger sein als eine größere Zahl an Neubauten. Dagegen lässt sich auch mit Informationskampagnen wenig ausrichten.
Wer als Experte solche Wertentscheidungen nicht ernst nimmt und die Leute bloß für uninformiert hält, der erledigt seine Aufgabe auch nicht unbedingt richtig. Am Ende hilft es vielleicht sogar, wenn man den Werten der Wähler in der Wissenschaft mehr Gewicht gibt und wenn Wissenschaftler ihre Fragen und Experimente mehr daran ausrichten. Mitautor Dolls sagt: „Ich bin kein Fan des Mietendeckels, aber wir müssen manchmal auch Faktoren in den Blick nehmen, die in der Bevölkerung eine Rolle spielen, aber in unseren Analysen vernachlässigt werden.“







