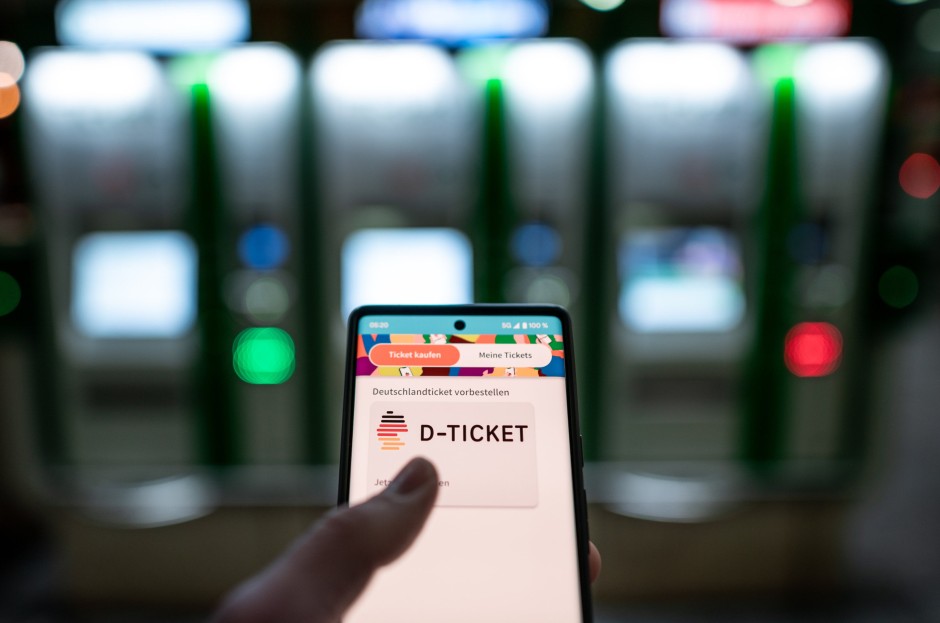
Die Begeisterung für das Deutschlandticket hat nach der ersten Preiserhöhung zu Beginn des Jahres merklich abgenommen. Bisher hat das im Mai 2023 eingeführte 49-Euro-Ticket kontinuierlich mehr Nutzer angelockt, im Dezember 2024 waren es sogar 14,5 Millionen. Mit der Steigerung des Preises auf 58 Euro im Januar sackten die Zahlen auf 13,4 Millionen Nutzer ab. Das zeigen Ergebnisse einer Marktforschung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Deutschen Bahn, die der F.A.Z. exklusiv vorliegen.
Ein monatsweiser Einbruch ist nicht ungewöhnlich. Seit Einführung der Flatrate für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in ganz Deutschland hat es immer wieder saisonale Rückgänge gegeben, etwa wenn mehr Menschen auf das Fahrrad umstiegen, denn das Deutschlandticket ist monatlich kündbar. Nun könnten die Quartalszahlen jedoch auf eine Trendumkehr hindeuten. Nach 14,2 Millionen Nutzern im vierten Quartal 2024 sank die Zahl im ersten Quartal 2025 auf 13,5 Millionen. Mehr als die Hälfte des Rückgangs (rund 430.000 Tickets) führt die Marktforschung auf die Preiserhöhung zurück. Bestätigt sich das durch die Verkaufszahlen, wäre das immer noch besser als erwartet: Prognosen gingen von einem Rückgang von bis zu neun Prozent der Nutzer aus, jetzt sind es etwa sechs Prozent.
Ticket-Verkauf an junge Leute bricht um mehr als ein Drittel ein
Dabei fällt besonders der Rückgang beim Jobticket ins Auge: So sank die Zahl um etwa 16 Prozent auf 2,2 Millionen. Dabei hatte sich die Branche umgekehrt einen deutlichen Schub von Unternehmen erhofft, die für ihre Mitarbeiter einen Teil der Kosten übernehmen. Auch bei jungen Leuten zwischen 14 und 29 Jahren brachen die Zahlen regelrecht ein – um mehr als 36 Prozent.
Als Konsequenz aus dieser verhaltenen Nachfrage fordert die Branche, künftig auf sprunghafte Preissteigerungen zu verzichten, sondern stattdessen auf „maßvolle, nachvollziehbare Preiserhöhungen“ zu setzen, zum Beispiel gekoppelt an einen Index. Außerdem müsse die Finanzierung von Bund und Ländern dauerhaft gesichert werden. Wegen der noch nicht abgeschlossenen Haushaltsverhandlungen ist dies nur bis Ende des Jahres der Fall. „Wenn man das Deutschland-Ticket zu einem verkehrspolitischen Erfolg machen will, muss man es jetzt dauerhaft verankern – sowohl in der Finanzierung, in der Ausgestaltung und auch mit einer deutschlandweiten Bewerbung“, sagte VDV-Geschäftsführer für den ÖPNV, Alexander Möller, der F.A.Z.
Die Finanzierung beruht dabei vor allem auf drei Säulen: Neben dem Preis und der Zahl der Nutzer gehören auch staatliche Zuschüsse dazu. Weil das Deutschlandticket auch mit 58 Euro im Monat noch deutlich günstiger ist als viele regionale Abomodelle, gleichen Bund und Länder die Mindereinnahmen aus – insgesamt mit drei Milliarden Euro im Jahr.
Nach Angaben des VDV reicht das nicht aus, es fehlen nach vorläufigen Schätzungen 400 Millionen Euro. „Der Bund und die Länder müssen entscheiden, die Ausgleichsleistungen in Höhe von drei Milliarden Euro zu dynamisieren, die Kostensteigerungen der Branche berücksichtigt werden“, sagte Möller. Über die Frage, ob es in den nächsten vier Jahren Preissteigerungen geben könne, gibt es mit dem Blick auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD offene Fragen. Dort ist von einem „stärkeren Einstieg in die Nutzerfinanzierung“ ab 2029 die Rede. Möller möchte darin keine generelle Absage an Preiserhöhungen sehen. „Es ist doch geradezu grotesk, dass alle Preise in Deutschland grundsätzlich flexibel sind – nur bei einem Produkt bis 2029 nicht, dem Deutschlandticket.“ Das Restsortiment wird in allen Verkehrsverbünden schließlich auch angepasst, weil die Kosten unter anderem für Personal und Energie stiegen.







