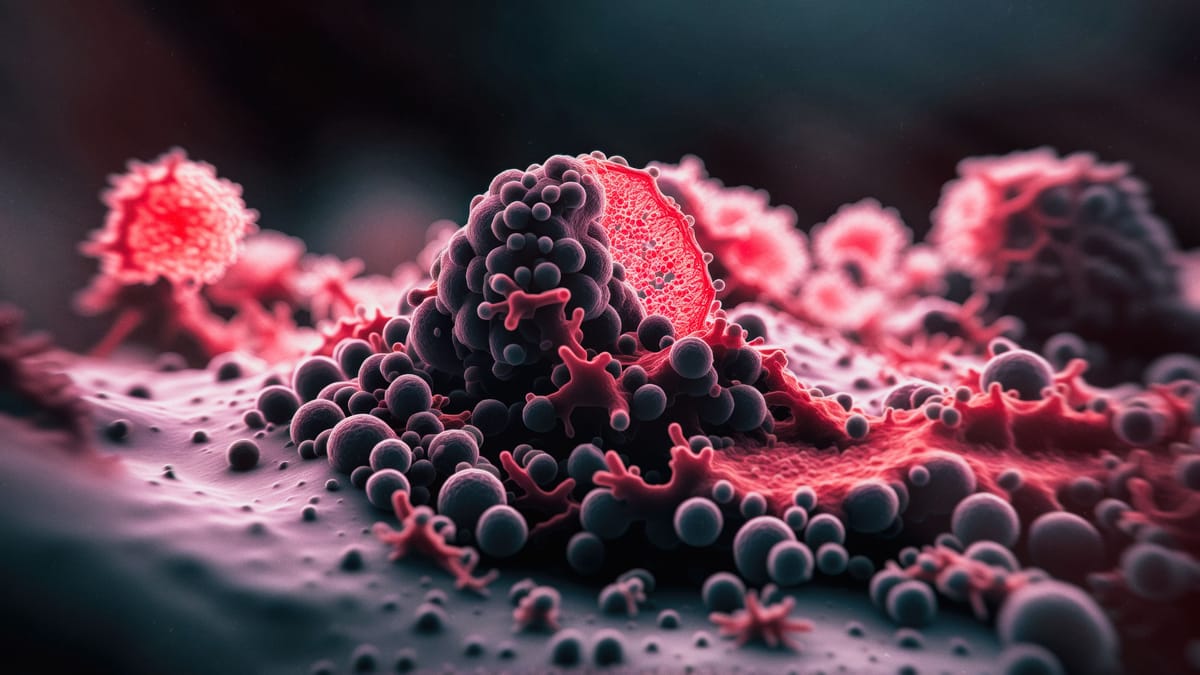
Schimpansen bekommen deutlich seltener Krebs als Menschen – trotz fast identischen Erbguts. US-Forscher haben jetzt einen möglichen Grund dafür entdeckt.
Menschen und Schimpansen sind sich genetisch zu über 98 Prozent ähnlich – und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied: Während bei uns Krebserkrankungen zu den häufigsten Todesursachen zählen, sind sie bei Schimpansen extrem selten. Lange wurde vermutet, dass das vor allem an unserem Lebensstil liegt – Rauchen, Umweltgifte, verarbeitete Lebensmittel. Doch nun haben Forscher der University of California, Davis (USA) einen genetischen Faktor entdeckt, der eine zentrale Rolle spielt.
Im Zentrum der neuen Studie steht ein Immunprotein namens Fas-Ligand (FasL), das auf bestimmten Immunzellen sitzt und entartete Zellen gezielt zerstören kann. Es ist ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen Krebs. Doch genau hier zeigt sich ein Problem: Beim Menschen kann das Enzym Plasmin, das in vielen Tumoren vorkommt, das FasL-Protein gezielt angreifen und dadurch deaktivieren.
Das bedeutet: Unsere Immunzellen verlieren ihre wichtigste Waffe gegen Krebszellen – und Tumore können sich ungestört ausbreiten.
Bei Schimpansen passiert das nicht. Ihre Version des FasL enthält an einer entscheidenden Stelle die Aminosäure Prolin, während Menschen dort Serin tragen. Diese winzige Änderung schützt das Affenprotein vor der Zerstörung durch Plasmin – ihr Immunsystem bleibt funktionstüchtig, selbst in der Nähe von Tumoren.
Doch warum haben Menschen diese Mutation überhaupt? Die Studienautoren vermuten einen evolutionären Tauschhandel: Die Genveränderung könnte unserem Gehirnwachstum Vorteile verschafft haben – auf Kosten einer robusten Immunabwehr. “Ein klassischer Kompromiss: besser denken, aber anfälliger für Krebs”, sagte Studienleiter Jogender Tushir-Singh.
Neben dieser biologischen Erklärung liefert die Studie auch praktische Hinweise für die Medizin. Denn sie erklärt, warum moderne Immuntherapien bei Blutkrebs oft gut funktionieren, bei Tumoren in Organen jedoch nicht: In Blutkrebszellen ist Plasmin kaum aktiv – FasL bleibt erhalten. In anderen Tumoren dagegen wird es durch Plasmin zerstört.
Das Team entwickelte daher spezielle Antikörper, die das FasL-Protein schützen oder das Plasmin blockieren. In ersten Laborversuchen konnten Immunzellen dadurch Tumore deutlich effektiver angreifen. “Dies ist ein wichtiger Schritt zur Personalisierung und Verbesserung der Immuntherapie für Plasmin-positive Krebsarten, die bisher schwer zu behandeln waren”, so Tushir-Singh.







