„Sie können alles, was ich besitze, was wirklich mir gehört, bequem auf einen Handkarren laden“, schrieb Heinrich Böll im Dezember 1951 an Georg Zänker, den Leiter des Middelhauve Verlags: „ich besitze keinen eigenen Stuhl, kein einziges Bett verbunden mit der Schuldenlast, die mir durch drei Jahre freier Schriftstellerei beschert ist“. Mehrfach hatte Heinrich Böll durch Ausbombungen im Krieg sein Hab und Gut verloren. Im Mai 1942 betraf das die erste gemeinsam mit seiner Frau Annemarie, geb. Čech, bezogene Wohnung in der Kölner Kleingedankstraße; sie telegrafierte an ihren noch an der französischen Kanalküste stationierten Mann: „Unsere Wohnung total vernichtet; keine Verletzten“. Auch auf die gemeinsame zweite Wohnung in der Neuenhöfer Allee fielen im Oktober 1944 Bomben (im Antrag ist zusätzlich von einer Ausbombung 1943 die Rede). Auch die elterliche Wohnung am Karolingerring brannte im Krieg aus. Nach 1944 darf Heinrich Bölls Privatbesitz als weitgehend verloren gelten, ein weiteres Trauma nach dem des sozialen Abstiegs der Familie in der Folge der Weltwirtschaftskrise von 1929, in der Bölls Vater sein Vermögen verloren hatte.
Was Böll in seinem Brief an Zänker nicht erwähnt, sind Bücher. Einige wird er 1951 wieder besessen haben (sie nehmen nicht viel Platz weg auf einem Handkarren), aber die von ihm als Germanistikstudent aufgebaute Arbeitsbibliothek – Böll sah sich seit spätestens 1938 als Schriftsteller – war bei den Bombenangriffen ebenfalls vernichtet worden. Der als Archivar am Historischen Archiv der Stadt Köln arbeitende Historiker Max Plassmann hat unlängst eine in diesem Zusammenhang sehr interessante Kölner Akte (Best. 520 A 873) erschlossen und darüber im „Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins“ (Band 85) berichtet. Es handelt sich um die Korrespondenz Heinrich Bölls mit der Kölner Stadtverwaltung mit dem Ziel, eine Entschädigung für seine kriegsbedingt verlorene Bibliothek im Rahmen des Lastenausgleichs zu erhalten. Der Vorgang wirft ein Schlaglicht auf das Selbstverständnis des Kölner Schriftstellers.
Im Herbst 1953 reichte Böll demnach seinen „Antrag auf Feststellung von Kriegsschäden“ ein. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits einige Werke von ihm in Buchform erschienen, so die Erzählung „Der Zug war pünktlich“ (1949), die Kurzgeschichtensammlung „Wanderer, kommst du nach Spa…“ (1950), der Antikriegsroman „Wo warst du, Adam“ (1951) und 1953 dann der Heimkehrer-Roman „Und sagte kein einziges Wort“. Die Schriftstellerwerdung war also abgeschlossen, nicht mehr bloße Selbstsicht.
Philologie, Philosophie und Pädagogik
Das Interessanteste an dem Antrag ist nicht der Versuch, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bölls materiell dennoch wenig abgesichert waren, eine Wiedergutmachung für die erlittenen Verluste zu erlangen. Dass Böll den Wert der Bibliothek in einer im Jahr 1955 eingereichten Schadensaufstellung mit üppigen 10.000 bis 11.000 Reichsmark angab, also vielleicht eher an der Obergrenze für eine Handbibliothek aus Buchhändlerlehrlings-, Soldaten- und Studententagen ansetzte, mag insofern verständlich sein. Zum Vergleich: Für den Hausrat aus der zweiten Wohnung erhielt er im Jahr 1961 eine Entschädigung von 2000 DM. Bereits während des Krieges hatte er, auch das geht aus dem Antrag hervor, eine erste Entschädigung von 4715 RM für die Hausratschäden in der Kleingedankstraße erhalten und erneut in Hausrat investiert. Die dabei ebenfalls verbrannten 320 Bücher seien nur die seiner Frau gewesen, gab Böll an, während seine eigene Bibliothek noch in der Elternwohnung am Karolingerring verblieben und dort im Folgejahr vernichtet worden sei.
Auch lassen sich aus dem Verfahren kaum Rückschlüsse auf den genauen Zuschnitt dieser ersten Bibliothek Bölls ziehen. Es wurden von ihm zunächst nur grob die Bereiche Philologie, Philosophie und Pädagogik genannt, berichtet Plassmann. Aus einer genaueren Aufstellung, die Böll 1965 nachlegte, geht hervor, dass zu der Sammlung Gesamtausgaben von Dostojewski, Tolstoi, Dickens, Goethe, Fontane und Hamsun gehörten, aber auch etwa die fünfbändige Geschichte der Stadt Köln von Leonard Ennen („sehr teuer“ laut Böll).
Was das Entschädigungsersuchen so interessant macht, ist vielmehr seine Dauer. Der Vorgang zog sich nicht nur durch die gesamten Fünfzigerjahre, in denen sich der Autor mit Büchern wie „Haus ohne Hüter“ (1954), „Irisches Tagebuch“ (1957) oder „Billard um halb zehn“ (1959) als viel gelesener deutscher Schriftsteller etablierte, sondern auch noch durch die gesamten Sechziger, in denen etwa der höchst erfolgreiche, weltweit übersetzte Roman „Ansichten eines Clowns“ (1963), ein Buch über den deutschen Katholizismus, erschien und Böll der Georg-Büchner-Preis (1967) zuerkannt wurde. Die Gleichzeitigkeit des Großen und Kleinen zeigt sich an einer Petitesse: Im Jahr 1965 wurde Böll wegen einer Unklarheit im Entschädigungsantrag aufs Amt vorgeladen, konnte aber nicht erscheinen, weil er gerade in Russland weilte. Er traf dort unter anderem auf die von ihm geschätzte Dichterin Anna Achmatowa, ein literaturgeschichtliches Datum, über das mehrfach geschrieben wurde.
Erst 1976 wurde die Akte geschlossen
Selbst nachdem Böll, finanziell längst sorgenfrei, den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte (1972) und in die politischen Stürme der Zeit hineingezogen worden war – daraus ging „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1974) hervor –, hielt er den Entschädigungsantrag über eine minimale Summe (inzwischen wären maximal nur noch 500 DM zu erwarten gewesen) weiter aufrecht. Erst 1976, neun Jahre vor Bölls Tod, wurde die Akte geschlossen. Böll war zuvor mitgeteilt worden, dass man in der entscheidenden Grundfrage seit den Fünfzigerjahren keinen Schritt weitergekommen war. Böll respektive sein Anwalt reagierten darauf nicht mehr.
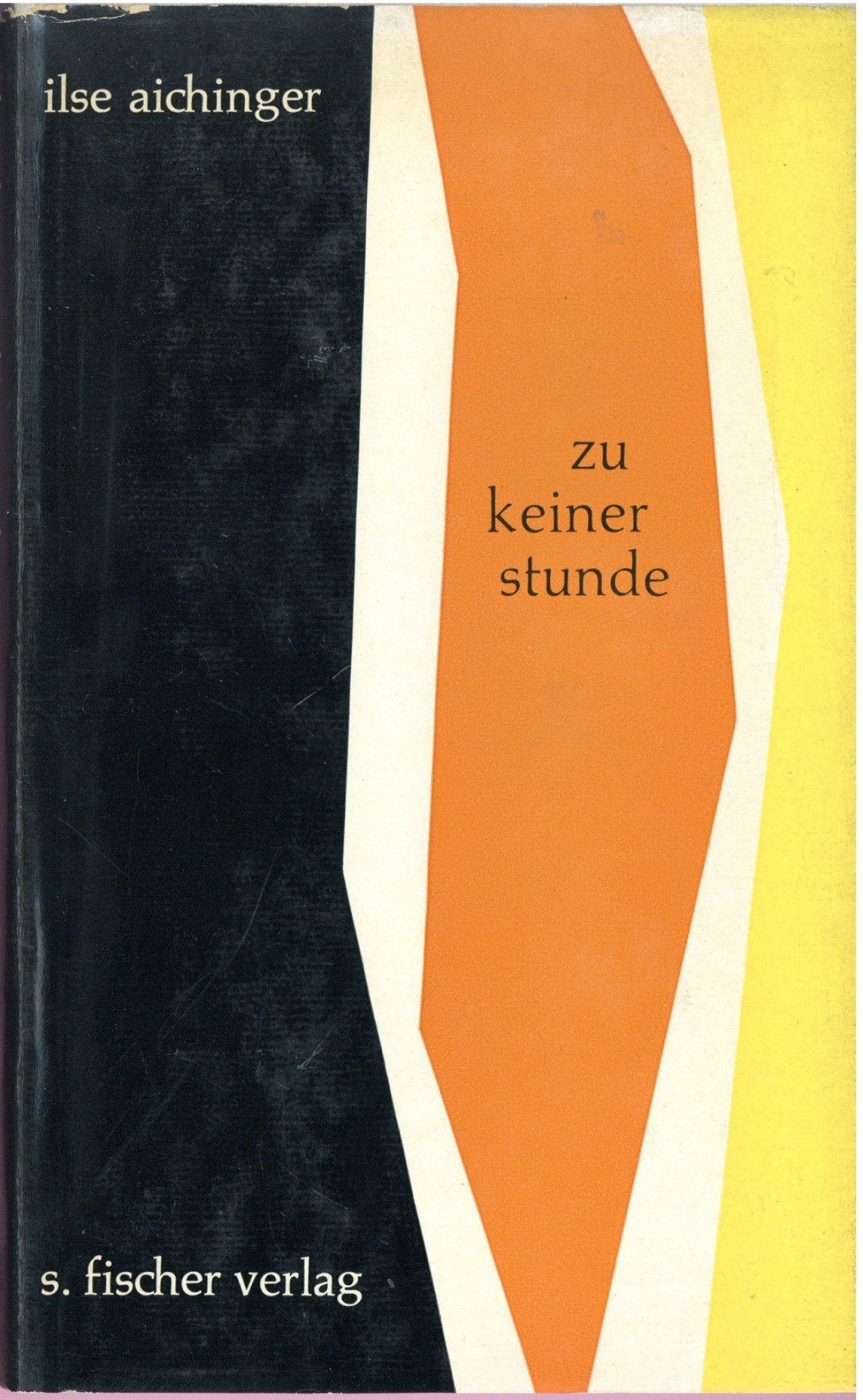
Warum sich die Prüfung so lange hinzog, lag also an einer einzigen, schwer zu entscheidenden, aber maßgeblichen Frage: War Böll, als seine Bibliothek abbrannte, ein selbständiger Schriftsteller oder nur ein Student und „Freizeitleser“ (Plassmann)? Nur wenn es sich bei der Schriftstellerei um einen Beruf und nicht nur um eine Berufung gehandelt haben sollte, wäre die Bibliothek als Arbeitsmaterial eines Gewerbetreibenden entschädigungsfähig gewesen. Böll selbst hatte die Verwaltung auf diese Idee gebracht, hatte er doch im Antrag von 1953 den dummen Fehler gemacht, als Beruf vor Eintritt des Schadens eben nicht „Schriftsteller“, sondern „Student/Soldat“ anzugeben. Das ließ 1965 den bearbeitenden Beamten aufhorchen. Er vermerkte: „Student? Wann 1. Buch veröffentlicht? Wieso 11000,- Bücher, nicht Altschaden?“ Bücher veröffentlicht hatte Böll tatsächlich vor Kriegsende nicht.
Der Literat, ob nun weltberühmt oder nicht, konnte trotz diverser beigebrachter Zeugenaussagen nicht nachweisen, zum Zeitpunkt des Schadens bereits Schriftsteller gewesen zu sein; das Amt aber konnte auch das Gegenteil nicht beweisen. Es gewann daher schließlich: das Amt. Weil ein Amt immer den längeren Atem besitzt. Plassmann stellt abschließend eine Mutmaßung über das Motiv Bölls an, diese Auseinandersetzung so unnachgiebig geführt zu haben. Er habe, heißt es, womöglich das amtliche Eingeständnis erzwingen wollen, „dass der bloße Entschluss eines jungen Menschen, seinen Lebensunterhalt mit der Schriftstellerei verdienen zu wollen, schon zur Anerkennung einer Berufsausübung qualifiziere“. Plassmann bringt die noble Absicht ins Spiel, Böll habe so vielleicht eine Diskussion über „die Sicherstellung des Lebensunterhalts des Literatennachwuchses“ anstoßen wollen. Das ist möglich, Böll hatte den literarischen Nachwuchs immer unterstützt. Vielleicht wollte er aber auch rückwirkend die für ihn schmerzliche Phase als Soldat mit der viel befriedigenderen Identität als Schriftsteller überschreiben. Oder es handelte sich schlicht um eine Amtsfehde, in die sich schon andere mit Kohlhaasschem Eifer hineingesteigert haben. Man wird es nicht mehr entscheiden können.
Dauerleihgabe der Familie
Während die Auseinandersetzung lief, hat Böll indes wieder eine Bibliothek aufgebaut. Wert auf bibliophile Ausgaben legte er dabei nicht, betont Gabriele Ewenz, die Leiterin des Kölner Heinrich-Böll-Archivs. Sie ist zuständig für die Betreuung und Erschließung dieser nachgelassenen Bibliothek Heinrich und Annemarie Bölls, die etwa 4000 Bände umfasst. Dass Böll nach den traumatischen Erfahrungen mit der verbrannten Bibliothek schon aus Vorsicht eher billig gekauft hat (viele Taschenbücher), glaubt Ewenz nicht: Es habe einfach Bölls Absicht einer reinen Arbeitsbibliothek entsprochen. Sie hatte keinen repräsentativen Zweck. Bis heute gehört diese Bibliothek Bölls Familie. Als Dauerleihgabe ist sie an die Stadtbibliothek Köln gelangt, zu der wiederum das in Zusammenarbeit mit den Erben Heinrich Bölls und der Heinrich-Böll-Stiftung e.V. betriebene Heinrich-Böll-Archiv gehört: eine kleine, aber beständige Forschungseinrichtung mit wenigen Mitarbeitern, deren Aufgabe neben etwa der Digitalisierung des literarischen Nachlasses (zugänglich aus Urheberrechtsgründen nur über das Archiv) heute besonders in der Literaturvermittlung besteht.
Anders als der literarische Nachlass (Manuskripte, Romanpläne, Briefe, Dokumente und einiges mehr), der von der Erbengemeinschaft in den Achtzigerjahren an die Stadt Köln verkauft wurde und zu größten Teilen im Historischen Archiv der Stadt Köln aufbewahrt wird, waren die Nachlassbibliothek, die Erstausgabensammlung und weitere direkt ans Böll-Archiv gegebene Materialien stets in der Stadtbibliothek untergebracht. Vom Einsturz des Historischen Archivs im März 2009 waren diese Teile des Nachlasses also glücklicherweise nicht betroffen. Mehr noch: Da sich ein guter Teil der Korrespondenz und der Manuskripte Bölls zum Zeitpunkt des Einsturzes im Heinrich-Böll-Archiv befand, wo gerade an der 2010 abgeschlossenen „Kölner Ausgabe“ der Werke Bölls gearbeitet wurde, konnten auch diese Teile des literarischen Nachlasses dem Unglück entgehen. Manches andere wurde zerstört (wenn auch weniger als zunächst befürchtet), vieles teils schwer beschädigt. Die Restaurierung dauert an.
Heinrich Böll selbst hatte zur Eröffnung der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Köln im September 1979 – ein damals gefeierter Prestigebau im Herzen der Stadt – sein Archiv dieser Institution und dem damit ins Leben gerufenen, von Bölls Neffen Viktor Böll bis 2009 geleiteten Heinrich-Böll-Archiv anvertraut (zunächst als Dauerleihgabe). Das war eine Rückkehr in die Heimatstadt, denn zuvor hatte die Boston University – peinlich für Köln – viele von Bölls Materialien aufbewahrt.
Das wiederaufgebaute Arbeitszimmer
Als später selbst der große Neubau am Neumarkt für alle Aufgaben zu klein geworden war, verlegte man das Böll-Archiv 1997 in ein frei gewordenes Bibliotheksgebäude in der Antwerpener Straße. Als ein verändertes Nutzungskonzept wiederum Raum in der Zentralbibliothek schaffte, kehrte das Böll-Archiv 2009 in den Zentralbau zurück. Von da an besaß es deutlich mehr Sichtbarkeit in der Stadt, weil auf dem umgebauten zweiten Stockwerk ein Bereich für Wechselausstellungen etwa über das Leben und Werk Heinrich Bölls geschaffen wurde. Das Prunkstück dieser Ausstellung war das hinter Glaswänden auf einer Fläche von 60 Quadratmetern aus vielen bis dahin eingelagerten Originalutensilien frei rekonstruierte Arbeitszimmer Bölls aus seinem letzten Wohnort in Bornheim-Merten. In diesem Zimmer fanden auch etwa zwei Drittel der Nachlassbibliothek Platz, offen sichtbar für alle Besucher.
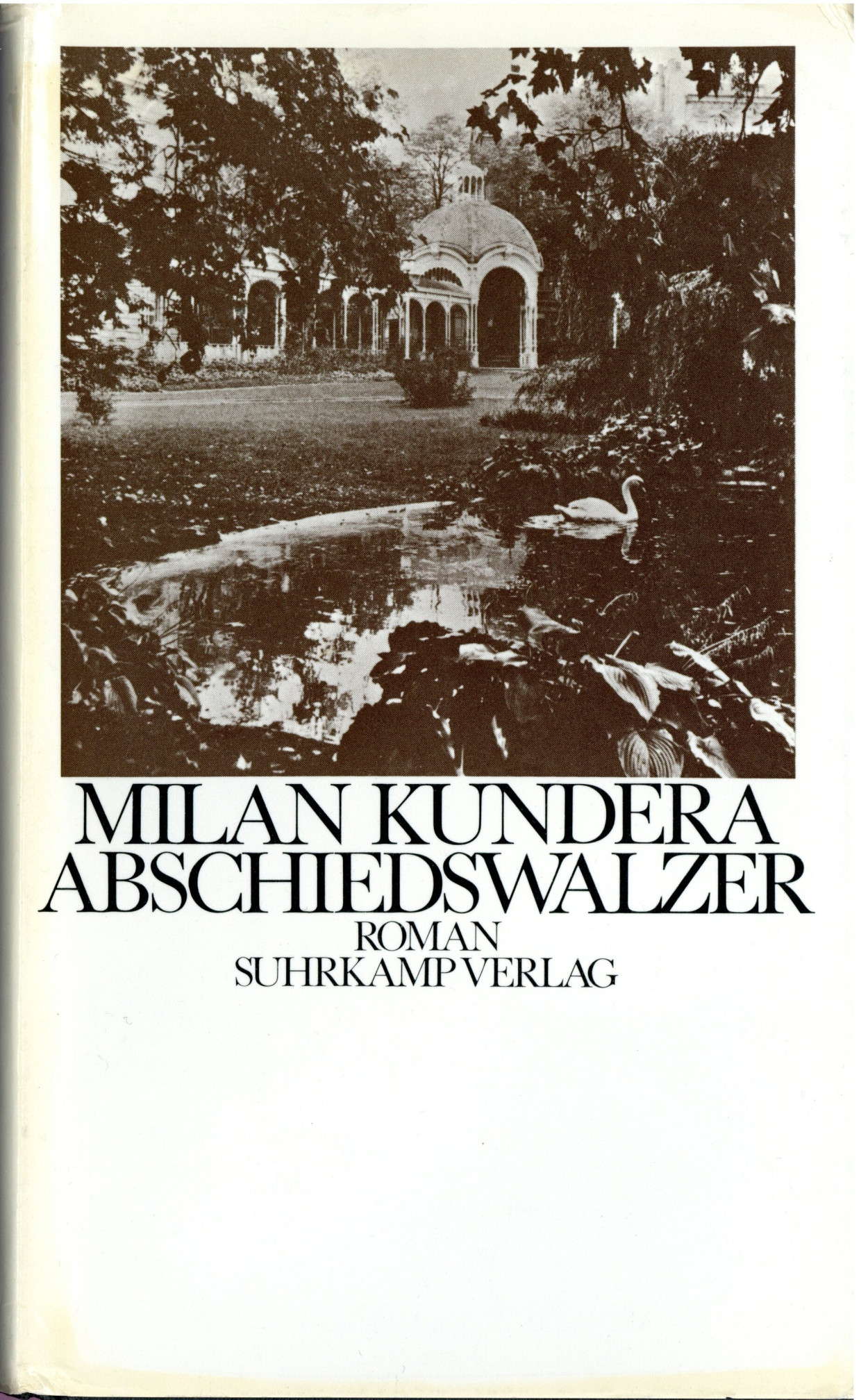
Umso bedauerlicher ist es, dass dieses Zimmer und die Bibliothek seit vergangenem Sommer bis mindestens 2028 nicht mehr zugänglich sind. Alles wurde im Kölner Umland eingelagert. Der Grund ist die Generalsanierung der Zentralbibliothek, die sich heute nicht nur inmitten einer der verwahrlosesten Zonen Kölns befindet – ein Drogenkonsumraum liegt nebenan, und die Gegend ist ein Hotspot für Obdachlose –, sondern mit Blick auf Haustechnik, Energieeffizienz und vieles mehr auch als Gebäude unrettbar veraltet war. Es wird nun bis auf das tragende Skelett entkernt, und alle hoffen, dass damit nicht eine weitere Ewigkeitsbaustelle in Köln entstanden ist.
Gabriele Ewenz und ihr Team wurden derweil mit der übrigen Bibliotheksverwaltung auf die gegenüberliegende Seite des Neumarkts in eine schmucklose Verwaltungsetage ausgelagert. Der Ausweichstandort für den Bibliotheksbetrieb selbst liegt in Kölns Fußgängerzone, in der Hohe Straße. Man wolle auch dort, erzählt Ewenz, eine kleine Präsentation zu Böll realisieren. Für Arbeitszimmer und Böll-Bibliothek ist im Interim aber kein Platz. Und auch die Sanierung des Ausweichgebäudes ist Monate nach der Schließung der Zentralbibliothek noch nicht abgeschlossen. Immerhin wurden kürzlich zwei einladend gestaltete Etagen sowie ein begehbarer Archivraum im Keller eröffnet; die übrigen Etagen folgen bis Ende des Jahres. Aus Anlass des vierzigsten Todestags von Heinrich Böll am heutigen Mittwoch sind im Erdgeschoss einige Böll-Titel auf einem Regal ausgestellt. In der runderneuerten Zentralbibliothek am Josef-Haubrich-Hof soll dann das Böll-Zimmer wieder so aufgebaut werden, wie es vor der Schließung war.
Die Hälfte der Bände ist erfasst
Zugänglich also sind Bölls Bücher für eine Weile nicht, erschlossen werden sie aber weiterhin. Für die Archivare ist das Zwischendepot zugänglich. „Unvollständige Verzeichnisse gab es schon zuvor“, sagt Ewenz, aber keine, die wissenschaftlichen Standards entsprochen hätten. Man habe inzwischen etwa die Hälfte der Bände in einer Datenbank erfasst. Dabei werde neben der genauen bibliographischen Verzeichnung überprüft, ob es Annotationen gibt, die dann digitalisiert würden. Die Ergebnisse sollen anschließend publiziert werden, und das möglichst ansprechend, also inklusive Faksimiles.
Für die Forschung sei diese Bibliothek wohl vor allem durch solche Arbeitsspuren interessant, nicht unbedingt schon durch ihre Zusammensetzung. Es handele sich schließlich um eine „Familienbibliothek“, in der sich etwa auch Annemarie Bölls Interesse als Übersetzerin spiegele. Anderes wurde dem Schriftsteller einfach von Verlagen zugesandt, ein gewisser Zufallsbestand: „Das sagt dann ja überhaupt nichts aus.“ Interessanter sei schon, ob ein Buch sehr zerlesen aussehe. Die Bibliothek umfasse deutsche wie internationale Literatur, englische und französische Ausgaben, einige Bücher zu Geschichte, Philosophie und Psychologie. Auch russische Autoren wie Lew Kopelew oder Alexander Solschenizyn seien natürlich darunter. Nicht direkt zu diesem Bestand gehören die getrennt aufbewahrten Bücher, die von den Bölls übersetzt wurden, sowie die Erstausgaben der Werke Heinrich Bölls in verschiedenen Sprachen. Und doch ergänzen sich alle diese Bestände, die auch in Heinrich Bölls Bücherregalen eine intellektuelle Koexistenz führten.
Während man von Bölls erster Bibliothek also nur weiß, wie schwer ihn deren Verlust traf, hat man seine letzte Bibliothek nach wie vor zur Hand. Und bei allen Einschränkungen, die man hinsichtlich der Zusammensetzung sicher machen muss, ist die persönliche Bibliothek eines Schriftstellers doch so etwas wie ein materielles Abbild seiner kreativen und poetologischen Persönlichkeit, eine tiefenscharfe Momentaufnahme seiner Vorlieben, Einflüsse und Marotten. Da bleibt zu hoffen, dass Bölls Bücher so schnell wie möglich wieder öffentlich zugänglich sein werden.







