An diesem Mittwoch unternimmt Europa noch einen großen, gemeinsamen Anlauf, Gehör in Washington zu finden, bevor sich am Freitag der amerikanische Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin in Alaska treffen, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Dem digitalen Gipfel, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz geladen hat, sind zahlreiche Gespräche in unterschiedlichen Formaten vorausgegangen seit dem Besuch von Trumps Sondergesandten Steve Witkoff bei Putin in Moskau vergangene Woche.
Dabei ging es nicht nur darum, die europäische Linie untereinander und mit der Ukraine abzustimmen und diese den Amerikanern vorzutragen. Es ging auch darum, herauszufinden, was genau von wem bei dem Witkoff-Besuch in Moskau angeboten oder gefordert worden ist. Vor dem digitalen Gipfel an diesem Mittwoch herrscht noch immer nicht volle Klarheit. Vorsichtig formuliert.
Um 14 Uhr sollen sich zunächst europäische Staats- und Regierungschefs zusammenschalten, neben Merz sollen jene aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland teilnehmen, sowie die EU-Kommissionspräsidentin, der EU-Ratspräsident, der NATO-Generalsekretär und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Das Gespräch dient der letzten Vorbereitung auf die Videorunde der Gruppe um 15 Uhr mit Trump und seinem Vizepräsidenten J. D. Vance. Eine Stunde ist für das Gespräch angesetzt.
Anschließend laden Deutschland, Frankreich und Großbritannien noch zu einem Gespräch der Ukraineunterstützer, der sogenannten Koalition der Willigen. Dazu gehören zahlreiche Staaten auch außerhalb der EU. Weil es mit den sicheren Leitungen für solche Gespräche nicht einfach ist, wird Merz seinen Urlaub unterbrechen und ins Kanzleramt kommen.
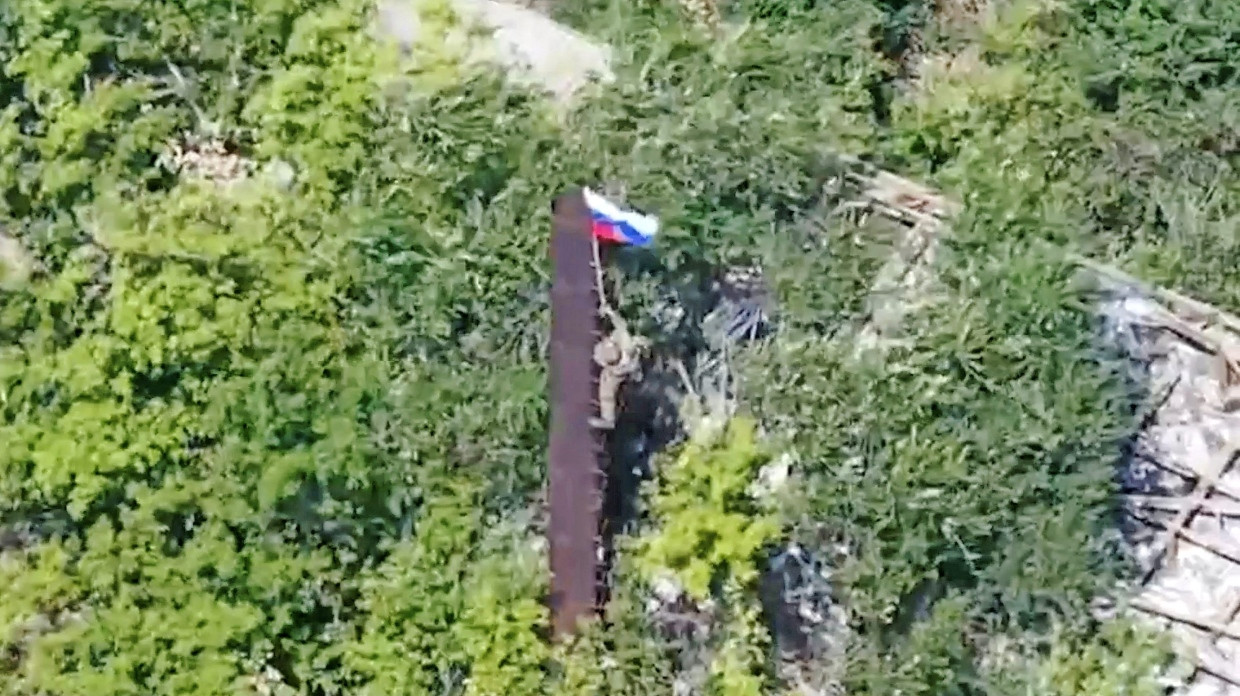
Bei Vance hatte man Einsicht wahrgenommen
Merz hatte Trump am Sonntag bei einem Telefonat zu der Gesprächsrunde eingeladen. Am Samstag hatten sich europäische Sicherheitsberater in London unter anderem mit Vance besprochen und dort die Idee für das Format entwickelt. Bei Vance meinte man auch die Einsicht wahrgenommen zu haben, sich mit der europäischen und der ukrainischen Position auseinandersetzen zu müssen. Tatsächlich können Kiew und die Europäer gegenüber Washington geltend machen, dass es keinen Deal geben kann, wenn die Ukraine diesem nicht zustimmt – und die Europäer nicht die Kosten für die Sicherheit der Ukraine tragen.
Als am Montag die Zusage aus dem Weißen Haus kam, verschickte das Kanzleramt die Einladungen. Die erste Botschaft, die die Europäer vermitteln wollen, ist stets: Die Ukraine muss mit am Tisch sitzen, Europa muss gehört werden. Konkret verbunden wird damit die Erwartung, dass das Treffen in Alaska nur der Auftakt sein kann für einen Prozess, in dem mindestens die Ukraine eingebunden ist. Ausgeschlossen werden sollen Zugeständnisse an Moskau, die entweder die Bündnisfreiheit der Ukraine beenden oder Folgen hätten für die europäische Sicherheit – zum Beispiel durch Absprachen zur NATO-Stationierung.
In einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der EU vom Dienstag wird hervorgehoben, „dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen“ und ein gerechter und dauerhafter Frieden, der Stabilität und Sicherheit bringt, das Völkerrecht achten müsse. Nur Ungarn schloss sich der Erklärung nicht an.
Eine flexiblere Formulierung
An diesem Mittwoch soll es darum gehen, wie weiter Druck auf Russland aufgebaut werden kann. Das entspricht der Reihenfolge, die man in Europa eigentlich verfolgt hatte: über Druck mit Sanktionen sollte Moskau zu einem Waffenstillstand und an den Verhandlungstisch gedrängt werden. Die Verhandlungsrealität ist nach dem Witkoff-Besuch in Moskau eine andere. Dieser Realität müsse man sich anpassen, heißt es in Berlin. Nach einer Schalte der EU-Außenminister am Montagabend hatte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ein neues Sanktionspaket der EU gegen Russland angekündigt, es wäre das 19. Daran anschließend soll es nun um die Fragen der Reihenfolge der nächsten Schritte gehen; was damit gemeint ist, steht auch in der Erklärung vom Dienstag: Sinnvolle Verhandlungen seien nur „im Rahmen eines Waffenstillstands oder einer Verringerung der Feindseligkeiten“ möglich. Auffällig ist, dass diese Formulierung flexibler ist als die bisherige Forderung nach einem Waffenstillstand als Voraussetzung für Verhandlungen.
Dann stehen die territorialen Fragen auf dem Programm – der Punkt, der seit dem Witkoff-Besuch für die meiste Verunsicherung gesorgt hat. Die Äußerungen von Trump dazu haben es nicht besser gemacht. Abgelehnt wird zwar in Kiew und Europa, dass Gebiete getauscht werden, die nicht von Russland besetzt sind. Allerdings hat nicht nur die Äußerung von NATO-Generalsekretär Mark Rutte deutlich gemacht, dass es von Russland eroberte Gebiete gibt, bei denen man bereit sein könnte, de facto die russische Kontrolle anzuerkennen – aber nicht de jure. Den Status der Gebiete könnte man in späteren Verhandlungen klären. Wichtig ist für Europa, dass der Ausgangspunkt für solche Vereinbarungen ausschließlich der Frontverlauf sein könne.
Schließlich soll es um die Frage nach Sicherheitsgarantien gehen, auch wenn die Antwort zunächst noch unkonkret bleiben dürfte, weil erst andere Schritte anstehen. In Europa scheint aber weiter die Stachelschwein-Lösung für die Ukraine bevorzugt zu werden: hochgerüstet soll sie in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Dass Trump ein Ende des Krieges will, daran zweifelt man in Berlin nicht. Was Putin will, darüber wird spekuliert. Trump zu sensibilisieren, dass er in Alaska auf einen Machthaber trifft, der bislang nur auf Druck reagiert hat und womöglich noch ganz andere Dinge im Sinn hat, wird in Berlin auch als eine wichtige Botschaft der Gespräche beschrieben.







