In einem hoch reflektierten autobiographischen Text über seine „bürgerliche Jugend“ hat der Historiker Thomas Nipperdey (1927 bis 1992) berichtet, dass sein Elternhaus durch „einen Restbestand von Religion, kulturprotestantischer Religion“ geprägt worden sei. „Mein Vater war Atheist, ein ordinärer Atheist, wie mein Doktorvater Liebrucks über unseren gemeinsamen Lehrer Nicolai Hartmann sagte.“ Die Mutter Hildegard hingegen „lebte mit der bürgerlich üblichen, etwas dünnen Kirchenbindung, Heiligabend und Karfreitag, und der Selbstverständlichkeit, dass Kinder in den Kindergottesdienst und zur Konfirmation gingen“.
Als die Tochter Dorothee 1949 neben Philosophie und Literaturwissenschaft auch Theologie zu studieren begann „und gar die rational maskierte und darum besonders ‚üble‘ liberale Theologie“, sei Hans Carl Nipperdey, ein einflussreicher Rechtsprofessor und speziell Arbeitsrechtler, „entsetzt“ gewesen. Wie er über die Studienwahl seines dritten Sohnes dachte, ist nicht bekannt. Aber es kann ihm nicht verborgen geblieben sein, dass Thomas sich in seiner Kölner philosophischen Dissertation sehr intensiv mit dem Christentum und dessen möglicher Geltungskraft unter den Bedingungen einer entscheidend von aufgeklärter Kritik bestimmten Moderne befasst hat.
1959 wechselte Liebrucks nach Frankfurt
Noch vor seinem ersten Staatsexamen wurde Nipperdey im Alter von gerade 26 Jahren im Sommer 1953 mit der Arbeit „Positivität und Christentum in Hegels Jugendschriften“ in Köln promoviert. Ob er sich das Thema selbst wählte oder Bruno Liebrucks es ihm vorschlug, weiß man nicht. Er mag im Sommersemester 1951 an Liebrucks Proseminar über Hegels Jugendschriften teilgenommen haben.
Liebrucks, der mit einer stark nationalsozialistischen Vergangenheit 1950 durch den Kantianer Heinz Heimsoeth als nichtbeamteter außerplanmäßiger Professor nach Köln geholt wurde und 1959 einen Lehrstuhl in Frankfurt erhielt, war ein bedeutender Sprachphilosoph, der nicht nur über Platon, sondern auch über die klassische deutsche Philosophie von Kant bis Hegel geschrieben hat. Als Nipperdey bei ihm promoviert wurde, lag der für die Hegel-Deutung grundlegende dritte Band seines Hauptwerks „Sprache und Bewußtsein. Wege zum Bewußtsein. Sprache und Dialektik in den ihnen von Kant und Marx versagten, von Hegel eröffneten Räumen“ allerdings noch nicht vor; er erschien erst 1966.
Im Literaturverzeichnis von Nipperdeys Dissertation wird kein einziger Liebrucks-Titel aufgeführt. Die Philosophen Sebastian Böhm und Thomas Sören Hoffmann, der über Josef Simon ein Enkelschüler von Liebrucks ist, haben gemeinsam mit dem Ökonomen Klaus Honrath die seinerzeit ungedruckt gebliebene Dissertation nun im Verlag von Duncker & Humblot ediert (Berlin 2024, 202 S., br., 69,90 €), leider mit erheblichen philologischen Mängeln und Fehlern im edierten Text.
Das Literaturverzeichnis ist eine Katastrophe
Die Editoren haben sich dafür entschieden, Nipperdeys Zitatnachweise durch Nachweise aus seitdem erschienenen kritischen Ausgaben zu ersetzen. Man wüsste indes gern, welche Ausgaben Nipperdey benutzt hat. Manchmal wird nach den Angaben der Kritischen Hegel-Ausgabe die entsprechende Stelle bei Nohl noch genannt, oft aber auch nicht. Zitate in Emanuel Hirschs Kierkegaard-Ausgabe werden nicht nach dem jeweiligen Band oder der entsprechenden Lieferung nachgewiesen, sondern sehr pauschal mit den Erscheinungsdaten der gesamten Ausgabe. Nach den Anmerkungen erschien sie von 1962 bis 1974, im Literaturverzeichnis aber von 1950 bis 1969.
Dieses Literaturverzeichnis ist insoweit eine Katastrophe, als hier die benutzten neuen Ausgaben mit den von Nipperdey genannten Titeln in einem Verzeichnis „Quellen“ nachgewiesen werden. Und offenbar hat niemand aufmerksam Korrektur gelesen. Ein so gebildeter Mensch wie Thomas Nipperdey dürfte „corruptio“ korrekt, also mit zwei ‚r‘ und nicht wie im edierten Text mit nur einem ‚r‘ geschrieben haben.
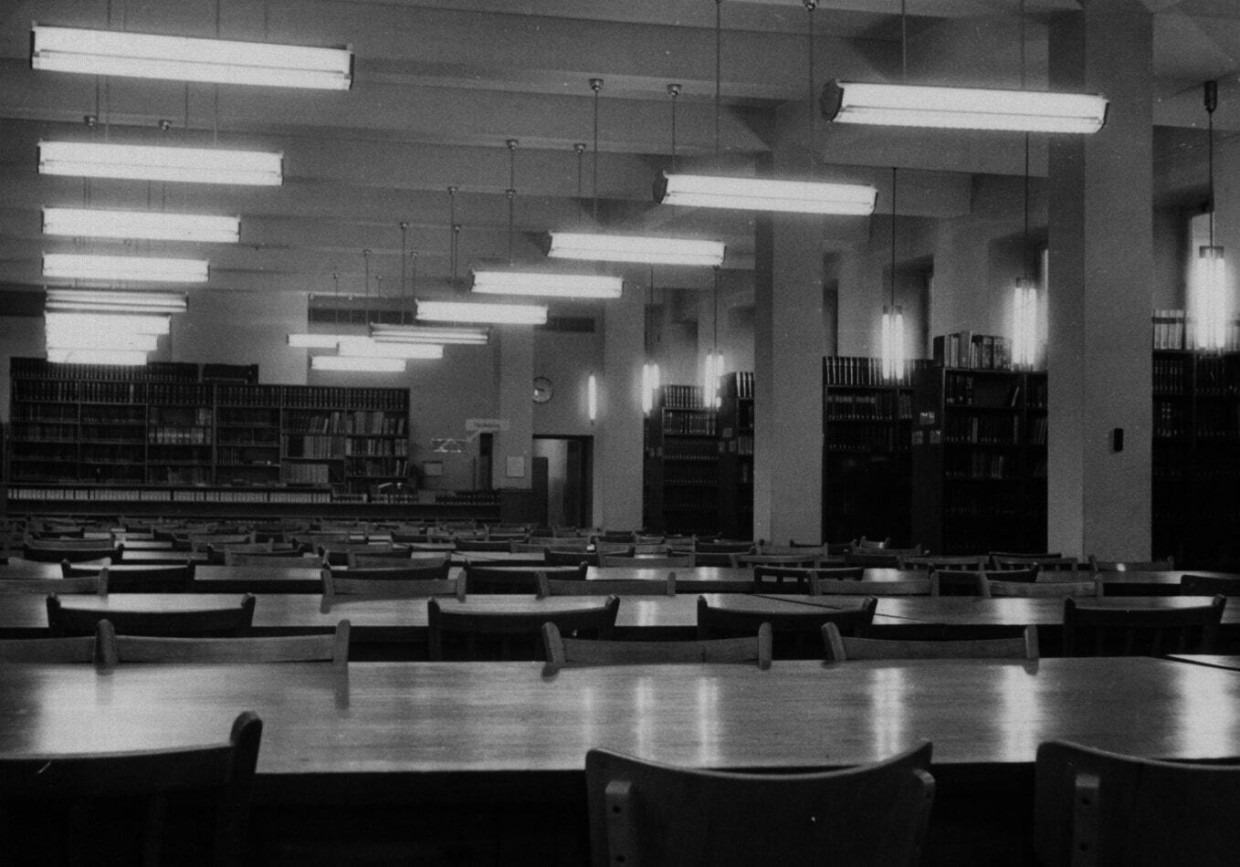
Im Promotionsverfahren ging alles sehr schnell. Der Doktorand reichte die handschriftliche Fassung seiner Arbeit am 19. Juni 1953 ein, und schon am 28. Juni schrieb Liebrucks sein Gutachten; Heimsoeths Zweitgutachten stammt vom 7. Juli. Wann das Rigorosum stattfand, erfährt man nicht. Auch wurden die Gutachten nicht mit ediert. Man wüsste gern aus eigener Lektüre, was denn die „Dissense mit den Gutachtern“ waren, von denen Hoffmann spricht.
Das Selbstverständliche, also Unausgesprochene
Nipperdey setzt sich ein hohes Ziel. Hegels Jugendschriften hätten eine „vorbereitende, hinführende Funktion für das Verständnis der Hegelschen Philosophie“. Sie könnten „unmittelbarer“ als das spätere Werk den „Zugang“ dafür eröffnen, „was für Hegel das grundlegend Selbstverständliche, darum zumeist unausgesprochen Bleibende“ gewesen sei. Es tue sich „zunächst kund in einem mehr oder minder expliziten, vorgängigen Verständnis, einer verstehenden Erfahrung von Welt, Mensch und Gott“, in deren „denkender umbildender Ausarbeitung und Begründung die Bildung und Analyse des philosophischen Begriffs“ erfolge.
Sein Verfahren, durch behutsame Interpretation des „maßgeblichen Anfangs des Hegelschen Philosophierens“ „das für und in Hegels Entwicklung Bewegende“ erfassen zu können, nennt Nipperdey „geschichtliches Verstehen“. Er grenzt sich von Autoren wie Theodor Haering, Hermann Nohl, Richard Kroner und Nicolai Hartmann ab, bei dem er in Göttingen studiert hatte, geht aber auch zu Georg Lukács und Franz Rosenzweig auf Distanz und betont, keine „biographische Entwicklungsgeschichte des Hegelschen Denkens“ bieten zu wollen. Er sieht „das Eigentliche in der Philosophie des jungen Hegel in einem gewissen Welt- und Selbstverständnis“. Dieses sei in einem emphatischen Sinn „geschichtlich“ und könne „nicht argumentierend“ widerlegt, sondern nur an „Gegenmöglichkeiten“ „in Frage gestellt“ werden.
Genau hier bringt Nipperdey Sören Kierkegaards „Gegenstellung“ gegen den Berliner Großsystemarchitekten ins Spiel. Die Fundamentalkritik des radikal frommen dänischen Antibürgers könne das „von Hegel Gedachte schärfer in seiner Art und vielleicht in seiner Grenze“ erkennen lassen. Dabei geht es zentral um den christlichen Glauben. Denn „Kritik und Interpretation des Christentums“ gehörten „wesentlich zum Gehalt“ von Hegels Philosophie, weshalb „das Verhältnis von Positivität und Christentum“ kritisch zu rekonstruieren sei.
Mit lutherischer Tradition vertraut
Nipperdey stützt sich auf Hermann Nohls 1907 erschienene Ausgabe von „Hegels theologischen Jugendschriften“. Texte wie die „Fragmente über Volksreligion und Christentum“, „Die Positivität der christlichen Religion“ und „Der Geist des Christentums und sein Schicksal“ zu deuten setzt viel theologische Kompetenz voraus. Der junge Thomas Nipperdey hatte sie, durch wen auch immer inspiriert. Er ist in Sachen Theologie hochgebildet und macht sich souverän Begriffe Rudolf Bultmanns und Friedrich Gogartens, des wichtigsten Lehrers seiner Schwester Dorothee Sölle, zu eigen. Er hat Paul Tillich gelesen und kennt von dessen Freund und nach 1933 politischem Antipoden Emanuel Hirsch, dem fanatischsten unter den NS-nahen Theologen, sogar das „Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik“.
Ausdrücklich übernimmt er Hirschs „Unterscheidung“ von „Gott als Herr und als Geist“. Souverän operiert er mit klassischen Distinktionen der theologischen Fachsprache und zeigt sich mit lutherischer Tradition vertraut. Er wagt den starken Satz, „daß die christliche Theologie m. E. die neutestamentliche Aussage über die jeweils faktische Verderbtheit des Menschen in eine solche über seine ‚Natur‘ verkehrt habe“ – womit er in meinen Augen recht hat. Sein starkes Interesse an „verständiger Theologie“, die er von „der vorstellenden Religion“ unterscheidet, macht er transparent: Die kritische Rekonstruktion von Hegels Kritik des Christentums setze „ein Verständnis davon“ voraus, „was Christentum ist oder bedeutet“. Das seine Arbeit „leitende erkennende Verstehen“ des Christentums sei „kein unausdrücklich vages, sondern ein expliziertes, näher bestimmtes und durch eine bestimmte Theologie angeleitetes“.
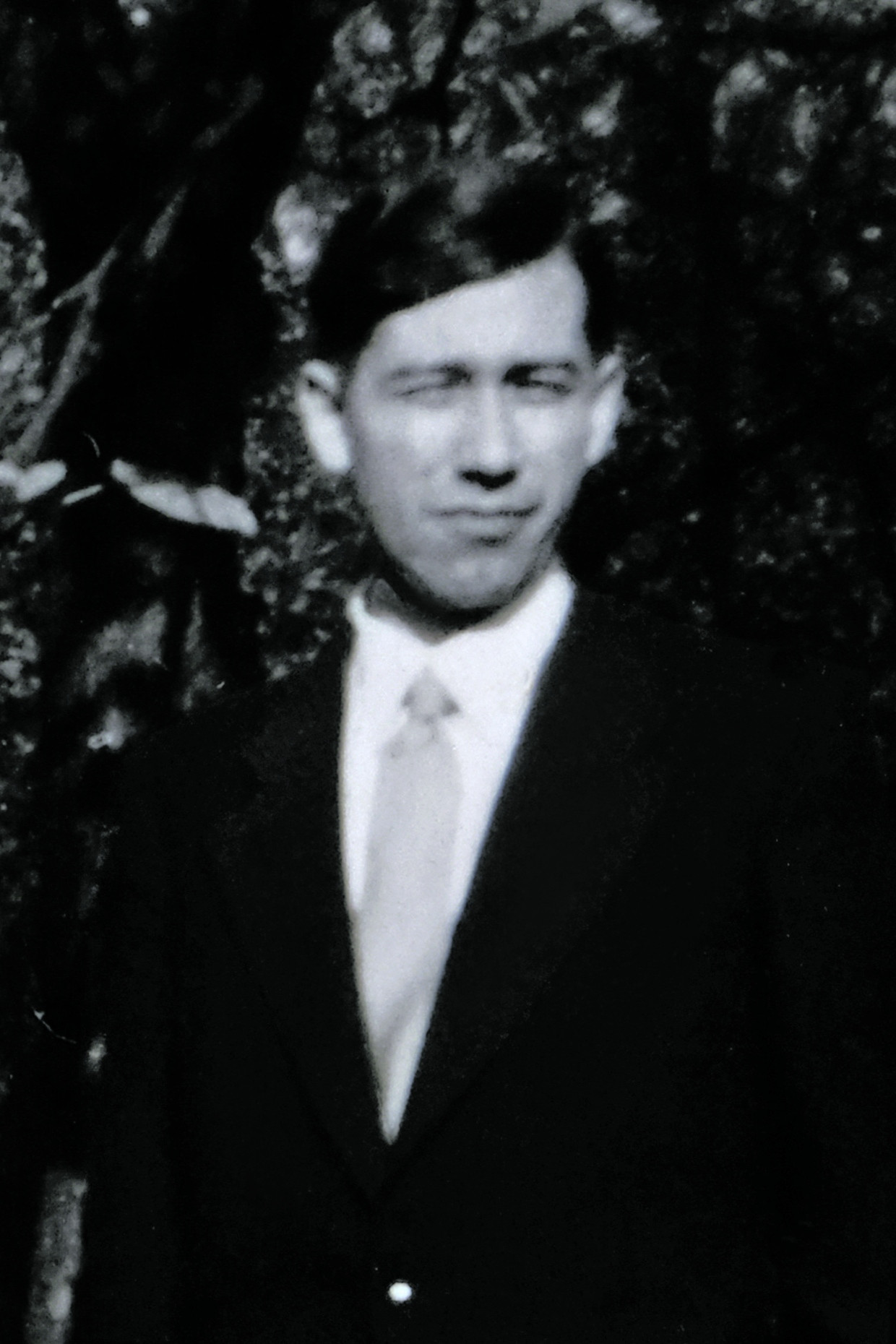
Namen nennt er nicht. Aber er legt ein Bekenntnis zum theologischen Existenzialismus ab: „Indem die christliche Rede von Gott nur noch existenzial möglich ist (Gott ist der, von dem her als von einem anderen der Mensch sein kann), weil alles andere Reden für die neuzeitliche Vernunft sinnlos ist, haben Aussagen über das ontische Verhältnis von Gott und Welt ihren eigentlichen Sinn verloren, so also die von Kierkegaard vielfach gebrauchten Ausdrücke Transzendenz und Immanenz, die allein auf ihren existenzialen Sinn hin befragt werden können.“ Nur so könne die „christliche Wahrheit“ wieder „subjektiv“ angeeignet werden. Nipperdey geht davon aus, dass christliches Reden von Gott in „der Moderne“ nur noch postmetaphysisch möglich sei.
Positivitätskritik zunehmend durch „Historisierung“ geprägt
Im Ersten Teil über „Kritik der Positivität“ geht es um Hegels kritische Sicht auf das Judentum und das Christentum, in denen das menschliche Leben „in Verkehrung der Wahrheit“ zur abstrakten Herrschaft eines Allgemeinen über das Besondere depotenziert werde. Positivität bringe Entzweiung und Entfremdung mit sich. Mit seinem Wunderglauben und der Vorstellung Gottes als des „machtübenden Herrn der Wirklichkeit“ mute das kirchliche Christentum der Vernunft zu, ihr „autonomes Urteil“ „auszusetzen, ja vernichten zu lassen“ und Wahrheit allein „auf Autorität Gottes, einer Schrift oder einer wie immer geleiteten Kirche hin anzunehmen“. Alle Autonomie, die des Volkes ebenso wie die des Einzelnen, sei vernichtet, sodass der Mensch nur Knecht Gottes als des Herrn sei.
Für Nipperdey ist dabei entscheidend, Positivität nicht als „die an sich seiende, bleibende Form“ oder „Un-Form“ des Lebens, sondern als „eine geschichtlich gewordene Unform“ zu deuten. Die Positivitätskritik des jungen Hegel sei zunehmend durch „Historisierung“ geprägt. Es gehe ihm um „den Widerspruch des institutionell, lehr- und gebotmäßig Überkommenen zu einer gegenwärtigen Selbstauffassung des Menschen“, also um das modernitätsspezifische Problem einer religiös fundierten Heteronomie, die alle Autonomie des Menschen zerstöre. Hegels Denken sei durch „das betroffene Erfahren der Zeiterscheinungen“ bestimmt.
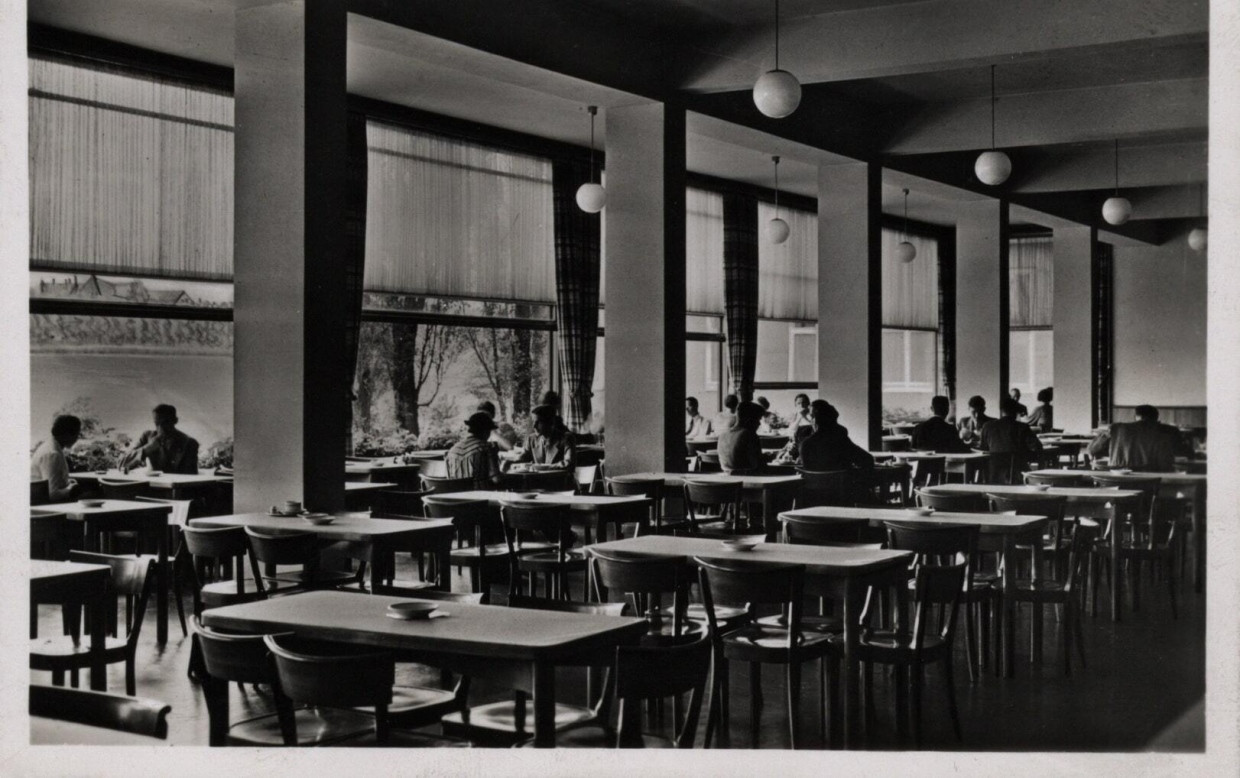
Mit Lukács betont Nipperdey, dass die Kritik der Religion ebenso wie die kritisierte religiöse Positivität einen „indirekt politischen Charakter“ habe. Das Religiöse sei keine Sphäre neben dem Politischen, sondern durchdringe dieses, indem sie es begründe und in ihren geschichtlichen Gestalten zugleich von ihm bedingt sei. Lebe der Einzelne nicht aus seiner apart gesetzten Subjektivität, sondern aus der „Vereinigung des Lebens“, deren „höchste Form“ der Staat sei, fielen Reich Gottes und Staat „und das Leben in diesem zusammen“. Hegel sakralisiere den dem Einzelnen vorgegebenen Staat zum „Allgemeinen“, in dem sich das sittliche Leben vollende. Der nicht als abstrakte Vernunftordnung, sondern als „die den Einzelnen überlegene Gestalt des geschichtlichen Lebens“ gedachte Staat wird zur „absoluten Sittlichkeit“ selbst.
Hegels Rechtsphilosophie und der Konservatismus
Hegel negiert jegliche Differenz zwischen dem Gott des Glaubens und dem Gott der Philosophen. Er will in einer „metaphysischen Ontologie“ das Christentum spekulativ begründen. Nipperdey macht sich hier Kierkegaards Einwand zu eigen, dass der Berliner Meisterdenker die intendierte Vermittlung von Gott und Mensch nur unter Abstraktion vom existenziellen Gehalt religiöser Vorstellungen denken könne. Weder werde Hegel dem zutiefst ernsten Faktum der Sünde gerecht noch werde der unbedingte Gegensatz zwischen Absolutem und Endlichem in seiner Nichtvermittelbarkeit erkannt. In seinen Figuren der Aufhebung werde die absolute Unterschiedenheit „ausdrücklich vernichtet“ und zu einer bloß relativen herabgesetzt.
In seiner antibürgerlichen Jugendphase ist dem Bürgersohn Nipperdey der dänische radikale Kritiker einer kommoden Bürgerreligion näher als der Berliner Allvermittler. Aber er sieht auch die Gefahr der „religiösen Absolutheit“ einer frommen Innerlichkeit, die als einzelne niemals in ein Allgemeines wie das Ganze des Lebens aufgehoben werden kann. Bei aller Begeisterung für Kierkegaard wahrt er immer wieder auch Distanz.

Im Sommersemester 1973 veranstaltete Thomas Nipperdey an der Universität München ein Seminar über die „Anfänge des europäischen Konservatismus“. Gelesen wurden Edmund Burkes „Reflections on the Revolution in France“, Texte Friedrich Julius Stahls und natürlich auch Bonald und de Maistre. Nipperdeys Erwartungen an die jeweils Referierenden waren hoch, und die Debatten wurden mit faszinierender intellektueller Ernsthaftigkeit geführt. Nach den Idealismus-Vorlesungen von Walter Schulz in Tübingen und sechs Semestern im Hegel-Oberseminar des Münchner Systematischen Theologen Falk Wagner hatte ich 1971 eine Examensarbeit über einen theologischen Hegelianer geschrieben und mit einer Dissertation über David Friedrich Strauß begonnen, jenen Tübinger Stiftsrepetenten also, der mit seinem „Leben Jesu, kritisch bearbeitet“ 1835 die Spaltung der Hegelschen Schule in Rechts- und Linkshegelianer provoziert hatte. So übernahm ich das Referat über Hegels Rechtsphilosophie im Verhältnis zum preußischen Staat.
Nipperdeys hermeneutische Maxime
Allu wissensstolz meinte ich in der Diskussion Nipperdey auf Bruno Liebrucks hinweisen zu müssen, nicht ahnend, dass er dessen Hegel-Deutung ungleich besser als ich kannte. Lange Jahre später, bei einer von Hartmut Lehmann und Günter Roth geleiteten Max-Weber-Konferenz im Deutschen Historischen Institut in Washington, fragte er mich abends, woher ich damals Bruno Liebrucks gekannt hätte. Nie zuvor habe ihn ein Student im Seminar an seinen Doktorvater erinnert. Nicht ohne Ironie fügte er hinzu: „Ich bin ja froh, dass Sie nicht wie meine Schwester geworden sind.“ Meiner Antwort, dass sie das Widerständige, Antibourgeoise des christlichen Glaubens ernster genommen habe als die neuliberalen Theologen ihrer Generation, stimmte er zu. Er mag sich an seine theologisch grundierte Kierkegaard-Faszination von einst erinnert haben.
In den Texten des jungen Hegel ließen sich die entscheidenden, auch das spätere Werk bestimmenden Motive seines Denkens erkennen, dies war Nipperdeys hermeneutische Maxime. Gilt dies auch für ihn selbst? Gibt es Kontinuitäten zwischen der Dissertation und der großen „Deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts“? Ja und Nein zugleich. Von einer Begeisterung für Kierkegaard finden sich in der „Deutschen Geschichte“ keinerlei Spuren; der dänische Religionsintellektuelle wird nun der jenseits oder am Rande der Kirchen lokalisierten „vagierenden Religion“ zugeordnet.
Ansonsten überwiegt die Treue zu den eigenen Anfängen. Schon der juvenile Hegel-Deuter wusste, dass sich Geschichte nie in einem System erfassen lässt. Der junge wie der ältere Nipperdey betonen, dass geschichtliches Denken den Abstand zwischen einst und jetzt ernst zu nehmen habe – weil nur so „das wesentliche Zur-Gegenwart-Bringen des Vergangenen die kritische Begegnung beider Zeiten“ ermögliche. Der Geschichtsschreiber des langen neunzehnten Jahrhunderts blieb als Historist darin von Hegel inspiriert, dass er die Angewiesenheit des Einzelnen auf das Allgemeine betonte: „Was wir sind und schaffen, sind und schaffen wir nicht von uns selbst.“ Hegelianisch ist auch das Motiv, Widersprüche auszuhalten und Negativität ernst zu nehmen.
Im Aufbau der „Deutschen Geschichte“ spiegelt sich zudem Hegels Grundunterscheidung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft: Nipperdey will in synthetischer Absicht die Fülle der Lebenswirklichkeit, also neben dem Politischen auch die Totalität der übrigen Kultursphären darstellen. Wie Hegel sieht der Spross des Kölner kulturprotestantischen Bildungsbürgertums im Bürgertum das „staatstragende Element“. Vor allem auch: Der Historiker Nipperdey weiß um die Macht der Religion. Davon mag den jungen Philosophen Hegel überzeugt haben.







