Die ukrainischen Demonstranten ziehen vorbei am bunten Karussell und den Schlittschuh fahrenden Kindern. Vorbei auch an den Leuten, die auf Fellen unter Heizstrahlern vor den Restaurants sitzen und staunen. „Hört auf, Geschäfte mit Russland zu machen. Norwegen wird nicht die Insel der Seligen bleiben, wenn Russland gewinnt“, schallt es ihnen entgegen. Ein Demonstrant zieht die Lautsprecher auf einem Bollerwagen hinter sich her. Vor ihm marschieren einige Ukrainer mit gelb-blauen Flaggen.
Das geht jeden Tag so. Dieses Mal sind rund zwanzig Ukrainer gekommen. Zuerst treffen sie sich vor dem Stortinget, dem prachtvollen Parlament im Herzen Oslos. Halten Reden, ermahnen die Norweger, dass es durch die Innenstadt schallt. Vor ihnen am Boden liegt eine rot beschmierte russische Flagge, Passanten gehen achtlos darüber hinweg. Die Ukrainer ziehen weiter die Prachtmeile hinunter in Richtung Königsschloss, dann links bis zur ukrainischen Botschaft. Dort werden die Flaggen eingerollt. Do sawtra, bis morgen, verabschiedet man sich.
„Wir machen das, damit die uns nicht vergessen“, sagt Rostyslaw Jewdijuchin. Er hat an diesem Tag die Demonstration angeführt. Das macht er viermal die Woche. Jewdijuchin arbeitet in der IT in Oslo, er kam schon 2011 ins Land. „Norwegen gibt nicht genügend Hilfe an die Ukraine, obwohl es aufgrund gestiegener Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas stark von dem Krieg profitiert hat“, sagt Jewdijuchin. Im Anschluss an die Demonstration sitzt er in einem Café, vor sich auf dem Tisch liegt sein Handy. Er hat die Website des staatlichen norwegischen Fonds geöffnet, in den all das Geld fließt. Man kann ihm live beim Wachsen zusehen, rasch steigt der Betrag. „Aber die Norweger haben das Geld nicht von irgendwelchen Aliens erhalten. Sondern von Europäern, die viel mehr für das Gas zahlen mussten“, sagt Jewdijuchin. Das sei zum Schämen.
Weniger Hilfe als Dänemark und Schweden
Infolge des russischen Angriffskriegs ist der Gaspreis massiv gestiegen. Norwegen hat als wohl einziges Land in Europa massiv von den Kriegsfolgen profitiert. Der Wert des Fonds, in den Norwegen seine Gewinne zum Wohle künftiger Generationen steckt, stieg rasant an. Zuletzt erreichte er den Rekordwert von 20.000 Milliarden Kronen. Das sind rund 1685 Milliarden Euro. Norwegens Hilfe für die Ukraine aber ist vergleichsweise gering. Zudem soll nach dem Willen Oslos nun auch noch die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die ins Land kommen, deutlich reduziert werden.
Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft gab Norwegen bisher weniger finanzielle und militärische Hilfe an Kiew als etwa seine Nachbarstaaten. Bisher waren es demnach 3,2 Milliarden Euro. Dänemark hingegen gab 7,5 Milliarden, Schweden 5,2. Bis 2030 hat die norwegische Regierung im Rahmen des sogenannten Nansen-Programms zugesagt, mindestens 15 Milliarden Kronen (1,2 Milliarden Euro) jährlich an die Ukraine zu geben. Insgesamt sollen es dann rund 150 Milliarden Kronen sein.

Das ist etwas mehr als ein Zehntel der Summe, die Norwegen Schätzungen zufolge allein 2022 und 2023 durch den gestiegenen Gaspreis verdient hat. Laut Finanzministerium betrugen die „außergewöhnlichen Einnahmen“ 1270 Milliarden Kronen. „Peinlich“ nennt das der Vorsitzende der norwegischen Grünen, Arild Hermstad. Was Norwegen an die Ukraine gebe, sei ein „Witz im Vergleich zu den zusätzlichen Einnahmen“. Die Regierung versuche zu leugnen, dass Norwegen das einzige Land sei, das von der Krise profitiert habe. Seinen Angaben nach betragen allein die jährlichen Gewinne des Fonds aus den zusätzlichen Einnahmen 80 Milliarden Kronen. „Das Geld hätte auf dem Schlachtfeld einen großen Unterschied gemacht“, sagt Hermstad. Norwegen müsse die zusätzlichen Einnahmen an die Ukraine geben und an Europa, damit sich das von fossilen Energien löse, meint er.
Niemand möchte den Fond antasten
Der norwegische Fonds wurde eingerichtet, damit auch künftige Generationen im Land von den heutigen Einnahmen aus Öl und Gas profitieren. Ihn in größerem Umfang anzutasten gilt als Tabu. Hermstad fordert ein Umdenken. „Anstatt ein fettes Bankkonto zu haben, wären die Leute in der Zukunft sicherlich auch froh darüber, wenn Russland weniger bedrohlich ist und wenn es mehr Freiheit und Demokratie gibt. Wenn wir die Ukraine stärker unterstützen, wird Russland schwächer. Das ist besser für uns alle“, sagt er. Außerdem: Selbst wenn Norwegen deutlich mehr Geld geben würde, würde das angesichts der Gesamtsumme des Fonds kaum einen Unterschied machen. Ohnehin sei Norwegen in Europa noch immer am „nettesten“ zu Russland, kooperiere etwa mit dem großen Nachbarn weiter beim Fischfang.
Vor dem Fenster des Osloer Cafés, in dem Hermstad sitzt, rauscht leise der Verkehr vorbei. Das Land ist Spitzenreiter bei Elektroautos; dank der günstigen Steuern sind unter den Neuzulassungen fast nur noch Elektrofahrzeuge. Darauf ist man sehr stolz. Ebenso darauf, dass der Strom dafür fast nur aus regenerativen Quellen stammt, vor allem aus Wasser- und Windkraft. Reich geworden aber ist man mit dem Export von Öl und Gas.
In der Regierung gebe es die Erzählung, dass Norwegen dem Klima helfe, weil es sauberere fossile Energien als andere Länder verkaufe, sagt Hermstad. „Aber das ist Schwachsinn.“ Das Gleiche gelte für die Pläne der Regierung, in der Tiefsee als eines der ersten Länder überhaupt Mineralien abzubauen mit dem Argument: Besser wir machen das als irgendjemand sonst. Norwegen lebe in einer Blase, geschützt vor der Außenwelt durch eine dicke Schicht Plexiglas, sagt Hermstad. Das Land genieße als Nicht-EU-Mitglied alle Vorteile der EU, wolle sich aber nie zu etwas verpflichten.
Bei den Flüchtlingen war man bisher großzügig
Vergleichsweise großzügig hat sich das Land bisher bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen gezeigt. Mehr als 86.000 Ukrainer erhielten bisher nach Regierungsangaben temporären Schutz, das ist mehr als in den Nachbarstaaten. In Schweden waren es zum Beispiel rund 72.000. Doch im September verkündete die Regierung drastische Änderungen bei der Aufnahme. Sechs Regionen im Westen der Ukraine erklärte die norwegische Einwanderungsbehörde für „sicher“. Ukrainer aus dem Westen des Landes erhalten damit nicht mehr automatisch wie in EU-Staaten einen Schutzstatus. Stattdessen müssen sie so wie Schutzsuchende aus anderen Ländern einen Asylantrag stellen, der individuell geprüft wird. Seitdem die Pläne Ende 2024 vorgestellt wurden, gehen die Zugangszahlen deutlich zurück. Für dieses Jahr rechnet die Regierung mit der Aufnahme von nur noch 18.900 Ukrainern.
Das liegt wohl auch an weiteren verschärften Regeln: Auch Ukrainer müssen nun erst einmal in die Erstaufnahmeeinrichtungen und können nicht gleich in die Kommunen gehen wie zuvor. Zudem verlieren sie ihren Schutzstatus, wenn sie in ihr Heimatland zurückreisen. Man sei zu den Veränderungen gezwungen, um den Schutzbedürftigen auch in Zukunft helfen zu können und die breite Unterstützung der Ukraine in der Bevölkerung sicherzustellen, teilte die Regierung dazu mit. Es gelte, die Einwanderung unter Kontrolle zu halten.
Bisher gibt es nach Angaben einer Regierungssprecherin rund 780 Fälle von ukrainischen Asylbewerbern, die keinen kollektiven Schutz erhielten. 67 Asylgesuche von Ukrainern seien abgelehnt worden, von diesen stammten einige auch aus den als „sicher“ eingestuften Gebieten.
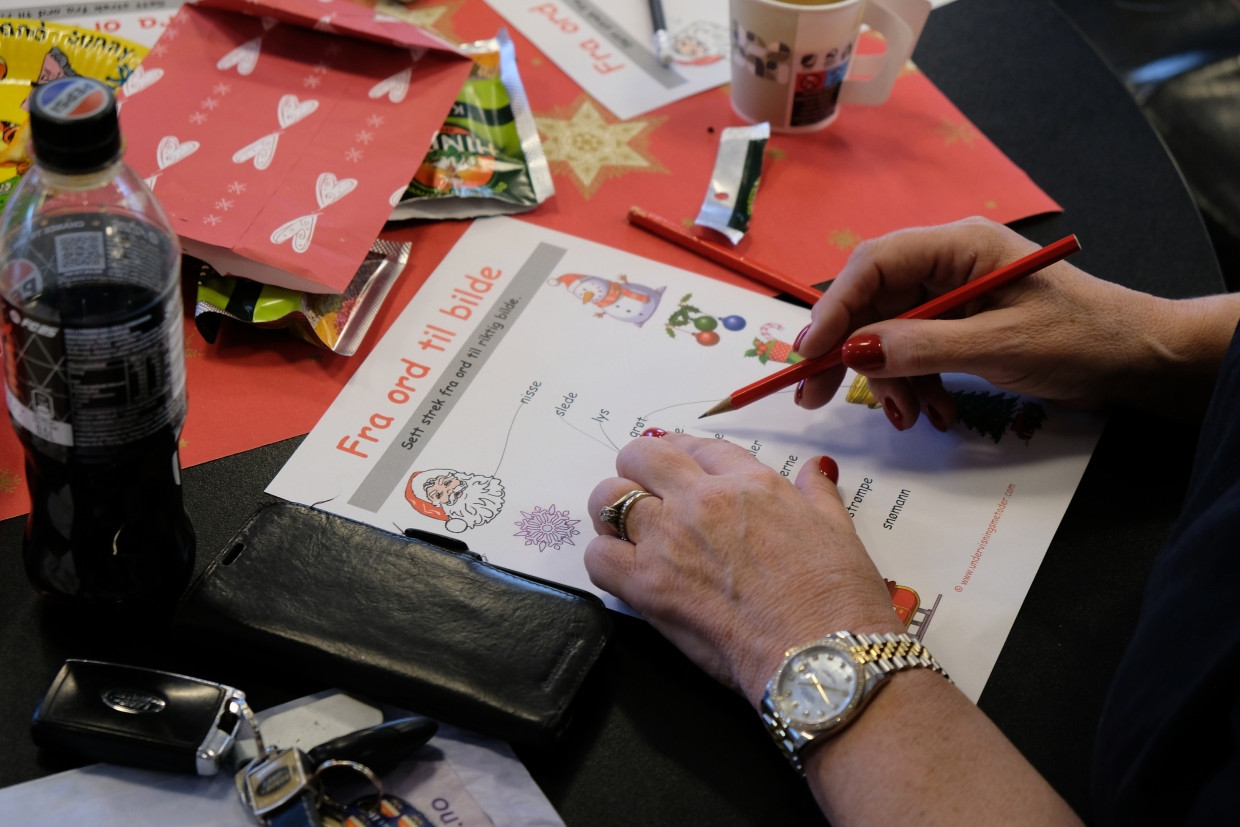
Auch der Westen der Ukraine sei nicht sicher, sie habe Verwandte dort, und es gebe immer wieder Raketenangriffe, sagt Natalija Orlowa. Norwegen rate doch seinen eigenen Bürgern auch, da auf keinen Fall hinzureisen. Orlowa ist Ukrainerin. Sie kam einst zum Studieren für zwei Jahre in die norwegische Stadt Drammen. Bei Kriegsbeginn machte sie mit ihrer Familie Urlaub in Polen. Zurück nach Kiew zu fahren war ihnen zu gefährlich, also flohen sie dahin, wo sie schon Leute kannten. Zuerst hätten sie nur einige Tage in Drammen bleiben wollen, daraus seien Wochen, dann Monate geworden. Mittlerweile arbeitet Orlowa, die zwei Masterabschlüsse hat, für die Kommune. Sie kümmert sich als Flüchtlingsberaterin um ihre Landsleute.
In Norwegen bestimmen die Kommunen selbst über Aufnahme
Drammen liegt am gleichnamigen Fjord, der die Stadt in der Mitte teilt. Die Stadt hat rund 110.000 Einwohner und ist nur rund eine halbe Zugstunde entfernt von Oslo. Hierher zieht es seit Langem viele Einwanderer. Ob das gut ist, darüber gehen in der Stadt die Meinungen auseinander. Im Frühjahr 2024 entschied der Stadtrat, in dem konservative Parteien und eine flüchtlingsfeindliche Partei die Mehrheit haben, nur noch ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Der Schritt sorgte für Empörung, Norwegens Ministerpräsident nannte ihn illegal. Die Entscheidung musste zurückgenommen werden. Der eigentliche Gedanke sei es wohl gewesen, bald niemand mehr aufzunehmen, heißt es dazu in der Stadt.
In Drammen leben nach Angaben von Eva Baustad, die für die Kommune die Flüchtlingsaufnahme leitet, 654 Flüchtlinge aus der Ukraine, dazu noch einmal rund 180 Flüchtlinge aus anderen Ländern. Die Integration verläuft ihren Angaben nach gut. Es gibt in Norwegen für Flüchtlinge bis zu anderthalb Jahre Sprach- und Arbeitsmarktförderung, 37,5 Stunden die Woche. Damit sei man sehr erfolgreich, so Baustad. Rund die Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge hat demnach mittlerweile eine Arbeit gefunden oder studiert. „Wenn man Geduld hat, werden viele eine Ressource für die Stadt sein.“ Auch Wohnraum habe man bisher stets finden können, auch wenn das nicht immer einfach sei.
Doch in diesem Jahr will die Stadt nur noch 58 ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. „Die Politik will so wenige Leute wie möglich aufnehmen“, sagt Baustad. Die Stimmung habe sich geändert, bei der Diskussion über das Thema stünden nun meist die Kosten im Vordergrund. Sie muss nun schauen, wie sie die gewachsene Zahl der Mitarbeiter in ihrer Abteilung wieder abbaut.
In Norwegen können die Kommunen selbst bestimmen, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen. Die Zahl teilen sie dann der norwegischen Migrationsbehörde (UDI) mit. Anders als in Deutschland, wo Länder und Kommunen Asylbewerber entsprechend eines bestimmten Schlüssels zugewiesen bekommen, nehmen in Norwegen einige Kommunen auch niemanden auf. Aber das sind wenige. Denn allen ist klar: Sollte das System scheitern, könnte ein Verteilschlüssel drohen.
Für Alte gibt es keine kostenloses Sprachkurse
Die Unterstützung für Flüchtlinge und Asylbewerber fällt im Land gerade im Vergleich zu den anderen nordischen Staaten hoch aus. Wer Schutz erhält, muss zunächst fünf Jahre an dem Ort bleiben, dem er zugeteilt wurde. Nach Ablauf der Frist zieht es dann viele gen Süden, etwa nach Drammen, wo es im Winter nicht ganz so lange dunkel und nicht ganz so kalt ist.
Zu sehen sind einige der neuen Anwohner Drammens immer dienstags beim „Sprachcafé“ in dem großen neuen Bibliotheksgebäude ganz vorn am Wasser. An runden Tischen nehmen sie Platz. Leute aus der Türkei, Iran, Indien, den Philippinen, Polen und der Ukraine. Vor allem Ältere kommen, um hier Norwegisch zu lernen. Denn sie erhalten keine kostenlosen staatlichen Sprachkurse. Ihnen gegenüber sitzen Ehrenamtliche der „Norwegischen Volkshilfe“, die mit ihnen üben. Viele von ihnen haben selbst eine Einwanderungsgeschichte, so wie Andreea, eine fröhliche junge Frau aus Rumänien, die vor sechs Jahren ankam und die Initiative anleitet.

Sie habe selbst hier auf diese Art Norwegisch gelernt, erzählt Andreea. Als Studentin habe sie keine kostenlosen Sprachkurse erhalten. Ob es leicht sei, sich in Norwegen zu integrieren? „Es kommt darauf an, woher du kommst und wie du aussiehst“, sagt sie lachend. Viele Norweger dächten, Einwanderer nähmen die Jobs weg, erzählt auch Eldar, ein Lette, der derzeit Arbeit sucht. Und in Norwegen würden Jobs vor allem an Familienmitglieder und Freunde vergeben, als Nichtnorweger sei es schwer. Viele Migranten änderten deswegen derzeit ihre Namen, das sei ganz einfach, nur ein Onlineformular sei notwendig, sagt Eldar. Gleiches erzählt auch Andreea. Die Leute wählten typisch norwegische Namen. Etwa Björn, Thor oder Margarethe, dann sei die Jobsuche viel leichter.
Offen seien die Norweger nicht gerade, sagt auch Natalija Popowa, eine Rentnerin aus der Ukraine, die den Sprachkurs besucht. Aber sie weiß auch Gutes zu berichten. Neulich sei sie auf der Straße gestürzt, da hätten ihr zwei Männer aufgeholfen. Eine ihrer Töchter lebt schon lange in Norwegen, deswegen kam Popova 2008 her. Die Sprache spreche sie kaum, sagt sie, aber ihr gefalle es, vor allem weil sie mit ihren gesundheitlichen Problemen gut versorgt werde. Dann zeigt sie Fotos aus ihrer Heimat, es ist die Stadt Jewpatorija auf der von Russland annektierten Krim. Dort habe es jetzt noch 20 Grad, sagt Popowa. Fragt man sie, ob sie ihre Heimat vermisst, fängt sie an zu weinen.
Sie wolle selbst entscheiden, ob sie und ihre Familie zurück in die Ukraine gingen, sagt die Ukrainerin Orlowa, die bei der Stadt Drammen arbeitet. Aber vermutlich blieben sie für längere Zeit. Man könne sich nicht auf etwas einlassen und dann wieder gehen. Ihr sechsjähriger Sohn gehe mittlerweile zur Schule, spreche Norwegisch, auch ihr Mann habe eine gute Arbeit gefunden, sie hätten eine Wohnung gekauft. Zudem hätten sie endlich Freunde in Norwegen gefunden. Und das dauere bekanntlich.







