Geschichtspolitische Konjunkturen können bewirken, dass zwischen Desinteresse und Begeisterung nur wenige Jahre liegen. Die 1919 von dem Düsseldorfer Stadtarchivar Paul Wentzcke vorgetragene Idee, angesichts der nach dem verlorenen Krieg verschärften Randlage des Rheinlands eine Jubelfeier als Bekenntnis zum Deutschen Reich zu veranstalten, verhallte zunächst fast ungehört. Sechs Jahre später aber war sie realisiert. Das Rheinland feierte seine tausendjährige Zugehörigkeit zum Reich. Die prominenteste unter den vielen Hundert Veranstaltungen war die Jahrtausendausstellung der Rheinlande in den Kölner Messehallen, die mehr als 1,4 Millionen Menschen besuchten. Kleinere Ausstellungen gab es in Düsseldorf, Aachen und zahlreichen weiteren rheinischen Kommunen. Hinzu kamen Festumzüge, teilweise nur umgewidmete Jahrmärkte und Schützenfeste sowie Festwochen, deren Programme politische Honoratiorenversammlungen ebenso umfassen konnten wie eine Kaninchenschau.
Es verwundert nicht, dass die Feiern in das kollektive Gedächtnis Eingang fanden und sich jetzt schon im Vorjahr des Jubiläums eine federführend vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte organisierte Tagung unweit der Kölner Messehallen mit den Ereignissen von 1925 und deren Folgen beschäftigte. In kleineren Städten und Gemeinden wurden Heimatschauen präsentiert, wie sie Guido von Büren am Beispiel Jülich vorstellte. Einzelne davon wurden Keimzellen neuer Heimatmuseen. Eine Besonderheit war die von dem Bonner Historiker Henning Türk untersuchte „Reichsausstellung Deutscher Wein“ in Koblenz, die das Reich im Titel führte und sich ausschließlich einem einzelnen – für nationalistische Anklänge offenen – Wirtschaftszweig widmete.
Zeitgenössische Bedenken
Dabei spielte der gesuchte Anlass des Jubiläums kaum noch eine Rolle. 925 hatte König Heinrich I. mithilfe des späteren Herzogs Giselbert II. Lotharingien dem Ostfrankenreich wieder einverleiben können. LVR-Kulturdezernentin Corinna Franz sprach von einer inszenierten tausendjährigen Zugehörigkeit des Rheinlands zum Deutschen Reich, der Potsdamer Zeithistoriker Rüdiger Graf äußerte scherzhaft, 2035 werde man gewiss in einer Zehnjahrfeier der Hundertjahrfeier der Tausendjahrfeier gedenken.
An der Relevanz des Themas für die geschichtswissentliche Forschung zur Weimarer Republik kann es keine ernsthaften Zweifel geben. In einigen Tagungsbeiträgen kamen zeitgenössische Bedenken zur Sprache: Wie in einer Demokratie zu erwarten, waren die Millionenausgaben nicht unumstritten. Der LVR-Institutsleiter Helmut Rönz erinnerte zudem daran, dass Reichsaußenminister Gustav Stresemann nationalistische Exzesse befürchtete, die seinen Entspannungskurs gegenüber Frankreich gefährden könnten. Martin Schlemmer vom Landesarchiv NRW ergänzte, die behördenähnliche Rheinische Volkspflege, die für die Reichsregierung die Situation im Rheinland beobachtete, habe ähnliche Sorgen gehegt.
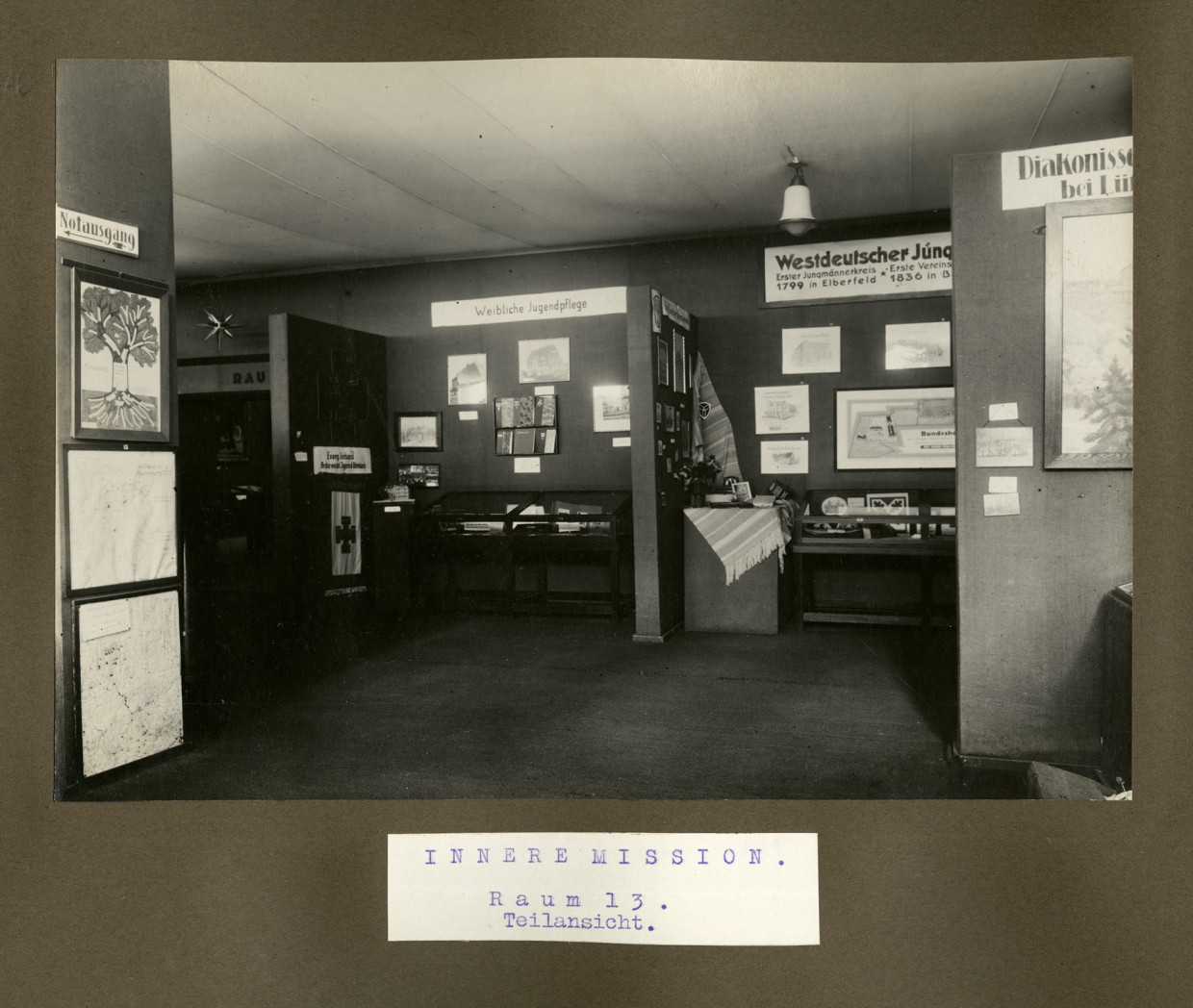
Auch die Teile des Rheinlands prägende, zunehmend international orientierte Schwerindustrie betrachtete das Jubiläum skeptisch und zeigte wenig Engagement, wie Ralf Stremmel, Leiter des Historischen Archivs Krupp, zeigen konnte. Die Bedenken führten in Berlin aber nicht zu einem Veto gegen das Jubiläumsprojekt. Das vom katholischen Zentrum geleitete Ministerium für die besetzten Gebiete übernahm die Koordination der Feiern auf Reichsebene und stärkte deren dezentralen Charakter. Die Dezentralität und der Verzicht auf ein verpflichtendes Credo erhöhten die Integrationskraft der Feierlichkeiten und machten das Jubiläum auch jenseits des topographisch fluiden Rheinlands anschlussfähig, wie es die Düsseldorfer Literaturwissenschaftlerin Gertrude Cepl-Kaufmann formulierte. Tatsächlich wurde vielerorts im Reich und selbst unter großdeutsch gesinnten Österreichern des Jubiläums gedacht.
Kritik an verzögertem Abzug
Die befürchteten nationalistischen Auswüchse suchte man von Berlin aus aktiv zu verhindern: Matthias Kordes (Recklinghausen) erinnerte daran, dass der eben gewählte Reichspräsident Paul von Hindenburg davon abgehalten wurde, das Rheinland während der Jahrtausendfeiern zu besuchen. Andererseits waren in Festzügen Parolen wie „Deutsche Ware ist besser“ zu lesen, was der Krefelder Stadtarchivar Olaf Richter anhand historischer Fotografien belegen konnte. Im Saargebiet gerieten den Forschungen der Historikerin Gabriele B. Clemens (Universität des Saarlands) zufolge die dort von 170 lokalen Festausschüssen organisierten Feiern vielfach zu einer massiven nationalen Demonstration. Die Region versank in einem schwarz-weiß-roten Fahnenmeer, nachdem die im Vergleich zu den Briten deutlich weniger liberalen französischen Besatzer das Hissen der Nationalflagge der Weimarer Republik auch zu diesem Anlass nicht genehmigt hatten. Sozialdemokratische und kommunistische Gegenkundgebungen blieben ohne nennenswerten Zulauf.
Die 1925 eingetretenen Verzögerungen beim Abzug der Besatzungsmächte aus dem Rheinland hatten selbst den gewöhnlich kalmierend auftretenden Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer beim Festakt im Gürzenich zu scharfer Kritik veranlasst. Gleichwohl stellte der Landeshistoriker Benedikt Neuwöhner für das Köln des Jubiläumsjahres ein einvernehmliches Miteinander von Einheimischen und Besatzern fest. Die Briten ließen in ihren Soldatenzeitungen Werbung für die Jahrtausendausstellung zu. „The Cologne Post“ übernahm in einer Ausstellungskritik sogar unkritisch das in den Messehallen gepflegte Narrativ von den Rheinlanden, die vor tausend Jahren gleichsam zum Nukleus der kulturellen Entwicklung des Reichs geworden seien. Vollkommen anders reagierte die frankophone Presse der Wallonie, über deren bisweilen spöttische Kritik an den Feiern Philippe Beck vom Zentrum für Ostbelgische Geschichte berichtete. Insgesamt scheint, folgt man dem Düsseldorfer Historiker Jamie Duponcheel, die Lage unter den belgischen und französischen Besatzern in Düsseldorf angespannter gewesen zu sein als in Köln.

Das Bild einer offen und liberal gestalteten Kölner Jahrtausendausstellung zeichnete Jürgen Wilhelm, der Vorsitzende der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Trotz des verbreiteten Antisemitismus sei der den Juden im Rheinland gewidmete Bereich fast ausnahmslos als gelungen empfunden worden. Der Direktor des Kölnischen Stadtmuseums Matthias Hamann sieht diesen Ausstellungsbereich sogar in einer direkten Linie zur epochemachenden Ausstellung „Monumenta Judaica“, die 1964 erstmals die jüdische Kultur entlang des Rheins in ihrer ganzen Vielfalt zum Thema machte.
Forschung zur Frauenbewegung
Weit über den der Kirche gewidmeten Abschnitt hinaus war die Ausstellung katholisch geprägt, wie der Bonner Historiker Keywan Klaus Münster darlegte. Dies provozierte Kritik vor allem außerhalb von Köln. Der in Hannover lehrende Kunsthistoriker Paul Schubring ließ sich seinerzeit vernehmen, es handele sich um eine christkatholische Schau ganz nach Adenauers Geschmack, die im Übrigen herzlich schlecht sei. Politisch denkenden Katholiken wie Carl Joseph Kuckhoff fehlte wiederum die explizite Darstellung eines selbstbewusst auftretenden Katholizismus.

Die im Kasseler Archiv der deutschen Frauenbewegung forschende Historikerin Kerstin Wolff machte deutlich, dass sich bis 1914 alle Themen der Frauenbewegung herausgebildet hätten. In Köln aber sei die Frauenbewegung fast ausschließlich als Trägerin von Aufgaben zur Erneuerung der Familie vorgestellt worden. Die von Münster belegte enge Kooperation zwischen Adenauer als Spiritus rector der Kölner Schau und dem Kölner Erzbischof Karl Joseph Kardinal Schulte ermöglichte freilich auch die Präsentation wertvollster Kirchenschätze wie des aus dem Dom über den Rhein in die Deutzer Messehallen gebrachten Dreikönigsschreins oder des Siegburger Annoschreins. Dass man insgesamt sich wenig um Repräsentativität kümmerte, konnte pointiert der Direktor des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs Ulrich Soénius zeigen, indem er auf die marginale Berücksichtigung des zeitgenössischen Handwerks in dem der Ökonomie gewidmeten Teil der Ausstellung hinwies.
So disparat die Jahrtausendfeiern mit ihren republikstärkenden, aber auch chauvinistischen Elementen waren, so sehr wirkten sie bis über die NS-Zeit hinaus identitätsstärkend. Zugleich hatte sich, wie der Mainzer Historiker René Schulz veranschaulichte, der für das Programm hauptverantwortliche Provinzialverband der Rheinprovinz, der Vorgänger des heutigen Landschaftsverbands Rheinland, als kulturpolitischer Akteur auf Dauer etabliert.







