Ob eine Koalition mit der Union vorstellbar ist, entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar. Und der historische Augenblick, in dem CDU und CSU, FDP und AfD im Bundestag per Handzeichen gemeinsam abgestimmt haben, wird dann nicht vergessen sein.
Sie verlangen von Merz eine Entschuldigung.
Herr Merz muss sich nicht bei mir persönlich entschuldigen, sondern bei der Öffentlichkeit. Dafür, dass er einen Konsens gebrochen hat, den er selbst formuliert hatte: dass keine demokratische Fraktion eine Mehrheit sucht, für welche sie die AfD brauchen würde. Auf jeden Fall können die Wählerinnen und Wähler jetzt entscheiden: Wer ist integer und vernünftig als Kandidat? Und nach dem, was Herr Merz unserem Land wissentlich und willentlich zugemutet hat, bin ich überzeugt, dass die Integrität des sozialdemokratischen Bundeskanzlers und Kanzlerkandidaten entscheidend sein wird.
Stellen Sie die persönliche Integrität von Friedrich Merz infrage?
Nein, aber er selbst hat seiner politischen Integrität schweren Schaden zugefügt.
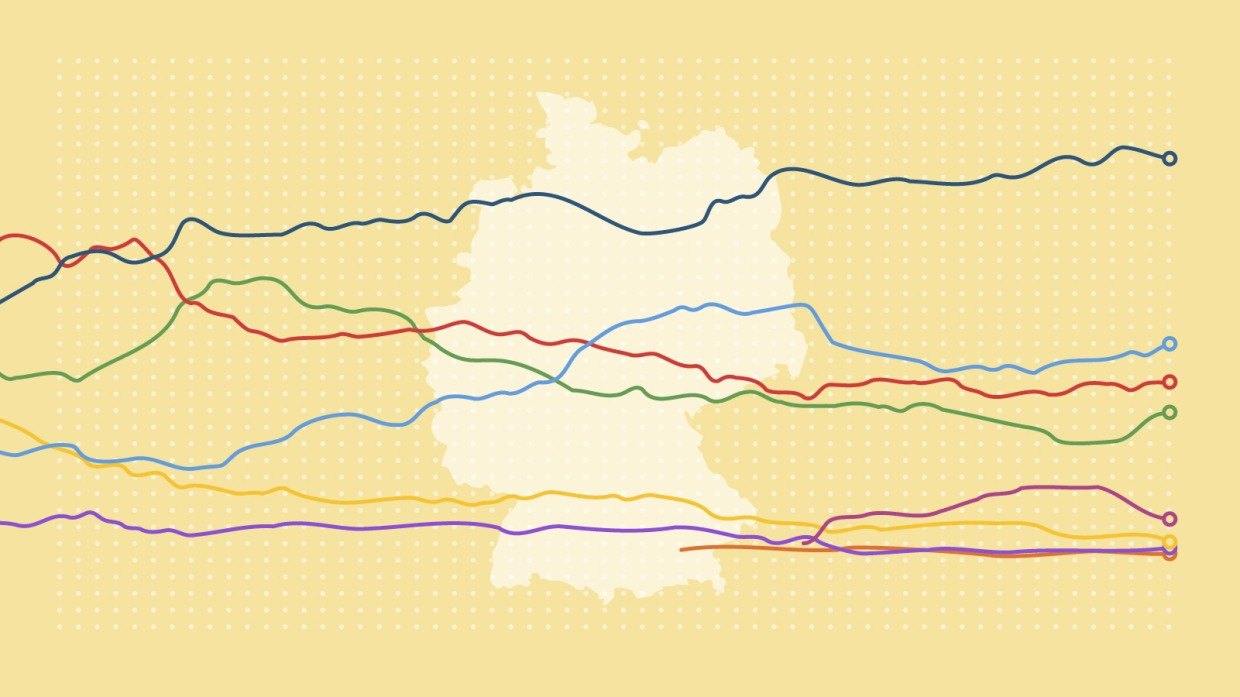
Ihre Behauptung trifft nicht zu, und das wissen Sie. Wir haben am Ende der Debatte im Bundestag vergangenen Freitag noch mal dafür geworben, alles, was Herrn Merz wichtig war, durch die Überweisung in den Innenausschuss wieder in die parlamentarische Beratung zu bringen. Dort hätten wir es zusammen mit den Gesetzentwürfen unserer Koalition zur gemeinsamen europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik, zum Bundespolizeigesetz und zu den weiteren Sicherheitsgesetzen verhandeln können. Das war ein gutes Kompromissangebot, das Union und FDP leichtfertig ausgeschlagen haben. Sie wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind gescheitert. Nun können wir immer noch unsere Gesetze beraten, aber das Gesetz der Union ist bereits abgelehnt.

Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Auch in Frankreich oder Österreich gelingt es demokratischen Parteien immer schwerer, sich zu einigen. Das stärkt dann die Ränder. Liegt das nicht auch an Fehlern der Linken?
Ich gestehe durchaus auch Fehler zu. Aber das kann man nur persönlich machen.
Dass ich meiner Fraktion viele Dinge abverlangt habe, auch mit brachialer Gewalt. Oder besser: mit brachialer Überzeugungskunst, egal wie Sie das nennen wollen. Und vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich den Kanzler nicht früher dazu bewegen konnte, der FDP eine klare Entscheidung für oder gegen die damalige Koalition abzuverlangen. Vielleicht hätte ich das bei den Haushaltsverhandlungen im letzten Jahr verlangen müssen. Aber das ist Schnee von gestern.
Gab es nicht noch ernstere Fehler? Hat die SPD nach den antisemitischen Vorfällen im Gefolge des Krieges in Gaza nicht zu spät bemerkt, dass Migration kulturelle Muster nach Deutschland bringt, die wir hier nicht wollen?
Der Maßstab ist das Grundgesetz, und wenn jemand dessen Werte und Bestimmungen verletzt, dann wäre es zu kurz gedacht, das allein einem Kulturkreis anzulasten. Das sind individuelle Fragen, denn Antisemitismus kommt schließlich nicht nur von außen. Er hat auch Wurzeln im westlichen Denken, in Deutschland zum Beispiel im extrem linken oder rechten Spektrum.
Ich kann mir da einen graduellen Weg vorstellen, zum Beispiel Gespräche mit der Taliban-Regierung im europäischen Kontext. Spätestens seitdem Frau Baerbock den Schritt nach Damaskus gewagt hat, wäre es gut, auch in dieser Richtung neue Wege zu suchen. Das wäre eine Außenpolitik, die mit den Realitäten umgeht, ohne sich mit diesen abzufinden. Der jetzige Ansatz, allein über die Regierung Qatars oder andere Mediatoren zu gehen, kann am Ende nicht so tragen. Wir machen uns dadurch von deren Wohlwollen allein abhängig.
Haben Sie bei Russland immer richtig gelegen?
Dass Russland in der Ukraine der Aggressor ist, habe ich nie in Zweifel gestellt.
Andere Sozialdemokraten, zum Beispiel Bundespräsident Steinmeier, haben zugegeben, dass sie da einiges falsch gesehen haben.
So, wie die Lage ist, wäre es ja auch seltsam, wenn niemand etwas falsch gesehen oder gemacht hätte. Ich habe aber den Eindruck, dass der Bundespräsident sich nicht als Bundespräsident entschuldigt hat, sondern als früherer Außenminister, und zwar in sehr allgemeiner Form.
Ich habe alle meine Kontakte zu Russland eingestellt, als es aus meiner Sicht keinen Sinn mehr ergab. Der letzte war 2016 bei den Schlangenbader Gesprächen, als ich einen Vortrag über Abrüstung und Rüstungskontrolle hielt. Im Übrigen habe ich keine Wirtschaftskontakte initiiert, sondern mich um Sicherheitspolitik und humanitäre Fragen bemüht. Trotzdem weiß ich, dass ich später manche Äußerungen oder Texte von Putin nicht so gelesen habe, wie man sie aus heutiger Sicht hätte lesen müssen. Das teile ich mit einer ganzen Zahl Politikern und Wirtschaftsvertretern. Mit Sicherheit müssen wir uns immer wieder überprüfen, was besser zu machen ist. Aber wir haben nicht nur Nachholbedarf. Im Gegenteil. Deutschland geht voran. Auch in Bezug auf Russland und die Ukraine. Herr Selenskyj hat mehrfach bestätigt, dass wir der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine sind, nach den USA. Wir reden nicht über andere, sondern tun was.
Im Verhältnis zur Wirtschaftskraft sind wir Nummer 15.
Sie beziehen sich da auf die Zahlen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Die sind von vielen in Zweifel gezogen worden.

Also gut, dann vielleicht Nummer zwölf?
Wir sind der zweitgrößte Geber nach den USA, was die absolute Unterstützung der Ukraine betrifft, und das wissen die Menschen in Deutschland und der Ukraine.
Dass wir in absoluten Zahlen Nummer zwei sind, ist eine Banalität, weil wir das zweitgrößte Land der NATO sind.
Herr Selenskyj hält unsere Unterstützung sicher nicht für eine Banalität, und er bedauert, dass es über die Ausfinanzierung zu einem Bruch der Regierung gekommen ist. Präsident Selenskyj weiß besser als manch deutscher Politiker, wie wichtig es auch ist, Deutschland auf einen wirtschaftlich stabilen Pfad zu bringen, um die Ukraine zu unterstützen.
Ihre Frage hat zwei Aspekte. Auf der einen Seite Trump als Person, auf der anderen Seite die Interessen der USA. Wenn ich Herrn Trump nehme, besteht die Gefahr, von der Sie reden, zweifelsohne. Wenn ich dagegen die USA als solche nehme, gilt das weniger. Aus Sicht der Hegemonialmacht USA ist der asiatische Raum zwar heute viel wichtiger als früher und das zentrale Wirkungsfeld. Und dennoch bleibt Europa auch für die USA weiter eine Kernregion. Allein schon wegen des Umfelds: Afrika, der Nahe Osten, die unmittelbare Nachbarschaft zu Russland. Nicht nur Europa braucht die USA, sondern die USA brauchen auch Europa – nicht nur, aber auch aus geostrategischen Gründen. Von daher würde ich nicht erwarten, dass sich die USA komplett aus der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik zurückziehen werden. Dass wir trotzdem einen viel stärkeren Fokus auf die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik brauchen, liegt auf der Hand. Aber ich wehre mich dagegen, nur einzelne Aspekte zu betrachten wie zum Beispiel die Militärausgaben. Das ist kein hinreichendes Kriterium für die Fähigkeit, eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu gestalten.
Aber vielleicht doch ein notwendiges?
Es ist notwendig, sich vor dem Hintergrund der Aggression Russlands gegen die Ukraine verteidigungsfähiger zu machen. Ich meine hier vor allem Abwehrfähigkeit, denn wir wollen ja keine Waffensysteme, die in einem Konflikt vorab eingesetzt werden können. Wir müssen uns zudem viel stärker darauf fokussieren, europäische Synergieeffekte zu erzielen. Das wird nicht reichen, aber zusammen mit höheren Verteidigungsausgaben ist dies sicher ein klügerer und seriöserer Ansatz, als über zwei Prozent, dreieinhalb Prozent und dann 3,85 oder fünf zu debattieren.
Im Augenblick haben wir einen Wehretat von knapp über fünfzig Milliarden Euro plus Sondervermögen. Wie müsste der 2028 aussehen?
Das wird eine der größten Herausforderungen für die neue Bundesregierung sein, die nötigen Aufwendungen für Verteidigung bereitzustellen, und zwar so, dass das Soziale, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Familien nicht darunter leiden. Bei der Verteidigung gibt es einen Mangel, und deshalb brauchen wir höhere Ausgaben. Die neue Bundesregierung wird die notwendigen Investitionen und die Schuldenbremse deshalb schnell aufeinander abstimmen müssen. Wir müssen die Verteidigung und die Ukrainehilfe mit den anderen großen Notwendigkeiten in Einklang bringen.

Ist das amerikanische Beistandsversprechen nicht so wackelig geworden, dass wir dringend mit anderen Atommächten wie Frankreich oder Großbritannien über eine eigene nukleare Abschreckung sprechen müssen?
Für die USA als solche werden die Verabredungen des NATO-Vertrags erhalten bleiben. Ob das für Herrn Trump gilt, werden wir sehen. Aber dass es zu einer engeren Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen Deutschland, Polen und Frankreich wird kommen müssen, ist offensichtlich. Das gilt auch für Italien und andere Länder wie Großbritannien.
Trump scheint jetzt einen Waffenstillstand zu wollen, in dem die Ukraine erst einmal auf ihre russisch besetzten Gebiete verzichtet. Auch Sie wollen den Konflikt „einfrieren“. Welche Garantien soll Kiew bekommen, damit Putin sich nicht gleich das nächste Stück holt?
Erst einmal: Nichts darf über die Köpfe der Ukraine hinweg entschieden werden. Dies vorausgeschickt wird man überlegen müssen, wie man einen Waffenstillstand überwachen kann und ob man vielleicht Räume definiert, in denen keine Waffen oder Ähnliches akzeptiert sind. Aber so weit sind wir leider noch lange nicht. Wenn es aber tatsächlich dazu kommen sollte, bin ich überzeugt: Die USA und Russland sollten dann Vereinbarungen zur Ukraine einbetten in glaubhafte Sicherheitsgarantien und weitere grundsätzliche Verabredungen, in denen strategische Abrüstung und Rüstungskontrolle auch eine Rolle spielen sollten. Aber das erfordert große Staatskunst, große Persönlichkeiten, und daran herrscht zurzeit großer Mangel.
Auch in Deutschland und der SPD?
Deutschland kann zu diesen Fragen mit Sicherheit viel einbringen. Das steht in unserer Tradition, und es entspricht dem Denken von Olaf Scholz.
Sozialdemokraten wie Willy Brandt und Helmut Schmidt haben Entspannung auf militärische Stärke gestützt. Jetzt wollen manche einen Waffenstillstand in der Ukraine durch internationale Truppen sichern. Sollte Deutschland da mitmachen?
Zunächst einmal: Wenn es ein Abkommen geben sollte, müsste es glaubhaft überwacht und garantiert werden. Dafür wird es einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats geben müssen, der sich auf Artikel 51 der UN-Charta beruft.

Der erlaubt allen Staaten, sich allein oder gemeinsam gegen Angriffe zu wehren. Muss also eine internationale Truppe sich gegen russische Provokationen verteidigen können?
Jede Truppe, die einen Waffenstillstand in der Ukraine sichern soll, muss sich grundsätzlich gegen jede Provokation verteidigen können. Sie muss in der Lage sein, das Ende der Gewalt auch militärisch abzusichern.
Eine internationale Friedenstruppe sollte auch aus den Ländern kommen, welche die internationale Ordnung heute stärker prägen als in der Vergangenheit.
Müssten auch Europäer mitmachen?
Einige europäische Länder haben das für sich ja schon angekündigt. In Deutschland entscheidet darüber der Bundestag.







