Es gibt drei Prinzipien, auf die der Verfassungsschutz achtet, um die AfD zu beurteilen: die Achtung der Menschenwürde, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. In den Gutachten, die eine Verfassungsfeindlichkeit der Partei feststellen, wird darauf hingewiesen, dass den Wahlprogrammen eine extremistische Kollision mit diesen Prinzipien nicht zu entnehmen ist, sieht man von „Verdachtssplittern“ ab – eine originelle Sprachschöpfung für den Graubereich.
Auf wen oder was lässt man sich also ein, wenn es um die AfD geht? Auf das gedruckte Wort, auf mehr oder weniger repräsentative Äußerungen? Beides ist relevant, wenn man beurteilen will, wie „anschlussfähig“ die Partei ist, anders gesagt: Wo berühren sich die Parteien noch, wo stoßen sie sich radikal ab?
Vor der Bundestagswahl von 2017 fiel das Wahlprogramm der AfD in etlichen Punkten schärfer aus als das Parteiprogramm. Das hat sich geändert. Während die Partei es in den vergangenen Jahren darauf anlegte, immer radikaler zu wirken, hält sich das Wahlprogramm jetzt in wichtigen Punkten zurück. Asyl und Migration spielen immer noch eine sehr große Rolle, aber Wirtschaft, Klima und die Europapolitik sind nicht minder prominent. Jeweils schlägt die AfD zwar radikale Töne an, verlässt aber nicht den Verfassungsrahmen.
SPD-Politik von gestern, Linke- und BSW-Politik von heute
Eine Zusammenarbeit auf diesen Feldern dürfte für alle Parteien aber ausgeschlossen sein: Der Euro wird als „Fehlkonstruktion“ für gescheitert, die EU als Bundesstaat für anmaßend-übergriffig erklärt; sie müsse deshalb in einen Staatenbund zurückverwandelt werden. In der Russlandpolitik könnte sich die AfD womöglich mit „Wandel durch Handel“ anfreunden: „Zur Wiederherstellung des ungestörten Handels mit Russland gehören die sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland sowie die Instandsetzung der Nord-Stream-Leitungen.“ Das ist SPD-Politik von gestern, Linke- und BSW-Politik von heute. Die Zukunft der Ukraine sieht die AfD als neutralen Staat ohne Aussicht auf einen NATO-Beitritt oder eine EU-Mitgliedschaft.
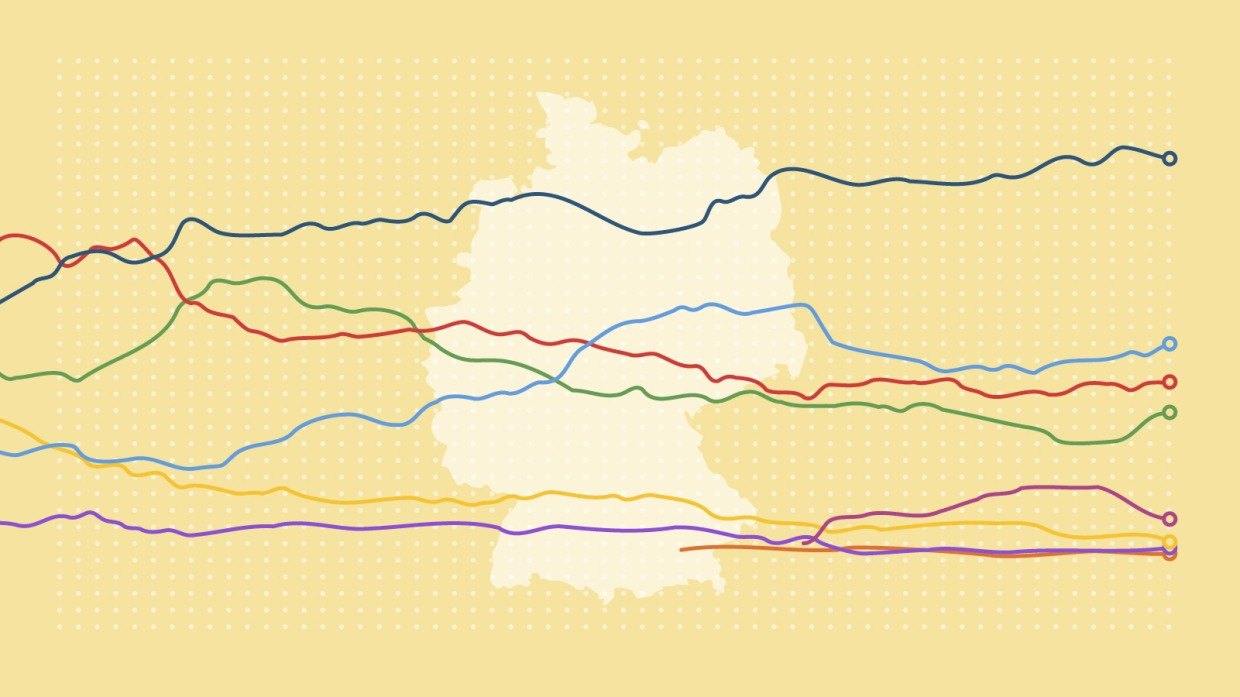
In der Wirtschafts- und Finanzpolitik schimmern immer noch die wirtschaftsliberalen Ursprünge der Partei durch. Sie will das Steuerrecht radikal vereinfachen, ohne Wenn und Aber die Schuldenbremse erhalten: „Wir setzen uns für eine Abkehr von übermäßiger Besteuerung und im Gegenzug für Ausgabendisziplin ein, um die Privathaushalte und unsere Unternehmen zu stärken sowie die Schuldenbremse einzuhalten und Verschuldung zurückzuführen.“ Viel konkreter wird die Partei hier nicht, die Nähe zur FDP oder CDU ist aber unverkennbar.
Die AfD begräbt die Klimapolitik
Das ändert sich, wenn es um die Wirtschaftspolitik im Lichte der Klimapolitik geht. Da strotzt die AfD vor radikalen Ansagen: weg mit dem CO2-Preis, weg mit dem Verbrenner-Aus, weg mit dem „Green Deal“ der EU, weg mit allen Subventionen für Windkraft oder Photovoltaik, weg mit dem Pariser Klimaabkommen, weg überhaupt mit der „Großen Transformation“, die „unsere Freiheit in erschreckendem Ausmaß“ bedrohe.
„Ob der Verbrennungsmotor eines Tages durch andere Antriebsformen abgelöst wird oder weiter existiert, muss wieder eine Frage des technischen Fortschritts sowie des Marktes werden und darf nicht auf ideologischer Verbotspolitik basieren.“ Einen weiteren Ausbau der Windkraft lehnt die AfD ab (ihre Kanzlerkandidatin Alice Weidel rief auch zur Demontage der existierenden Anlagen auf). Und: „Neben dem kurzfristig notwendigen Ausbau von Kohlekraftwerken planen wir den Wiedereinstieg in die Kernenergie.“
Die AfD begräbt damit die Klimapolitik, die vorerst noch von allen anderen Parteien propagiert wird – mit ersten Abstrichen allerdings, vor allem bei der FDP, deren liberales Credo die AfD an solchen Stellen durch eine liberal-anarchische Note noch übertreffen will. Die Grünen sind hier der Hauptfeind der AfD, auch deshalb, weil für die AfD die grüne Transformation auf einen (roten) „Gesellschaftsumbau“ zielt, den sie „vehement“ ablehnt.
Für ihre Klimapolitik, wenn man sie überhaupt so nennen will („das Klima kann der Mensch nicht schützen“), ist die AfD mit keiner Partei auf Kompromisse aus. Verfassungsrechtliche Schwierigkeiten ergeben sich daraus zwar im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber nicht im Sinne einer Verfassungsfeindschaft. Während Karlsruhe die Freiheit durch Unterlassung bedroht sieht, hält die AfD die Freiheit gerade durch illusionären Klimaschutz für gefährdet. Keine der anderen Parteien dürfte ihr darin folgen.
Wie sieht es aber nun mit den drei anfangs genannten Prinzipien aus? Sie betreffen die Passagen zur Migration, zur Integration, zum Islam und zur (direkten) Demokratie. An etlichen Punkten des Programms von 2017 hält die AfD fest. Nach wie vor propagiert sie eine Abkehr vom derzeitigen Staatsangehörigkeitsrecht, das dem „ius soli“ folgt, und befürwortet stattdessen die Rückkehr zum „ius sanguinis“, also dem Abstammungsprinzip, das bis in die Achtzigerjahre in der Bundesrepublik galt.
Einbürgerungen soll es für die AfD erst nach zehn Jahren Aufenthalt in Deutschland geben. Die AfD wolle zum „Rechtszustand zurückkehren, wie er bis 1990 bestanden hat, also dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt als Kind zumindest eines deutschen Elternteils sowie als Ermessensentscheidung im Interesse des Gemeinwesens“. Vor acht Jahren hatte sie Assimilation als Voraussetzung genannt. Das Wort fehlt nun im Wahlprogramm.
Einwanderung wird nicht pauschal abgelehnt
Einwanderung wird nicht pauschal abgelehnt, sondern: „Leitgedanken bei jeder Form von Zuwanderung müssen die Integrationsfähigkeit und Integrationswilligkeit von Migranten sein sowie die Integrationsmöglichkeiten der Aufnahmegesellschaft und ihres Staates.“ Richtschnur dafür müsse die „deutsche Leitkultur“ sein, über die es heißt, sie beschreibe „unseren Wertekonsens, der für unser Volk identitätsbildend ist und uns von anderen unterscheidet. Sie sorgt für den Zusammenhalt der Gesellschaft und ist Voraussetzung für das Funktionieren unseres Staates.“ Auffällig ist das Wort „deutsch“, das in der Leitkultur-Version der CDU/CSU fehlt.
Überschneidungen mit der CDU/CSU gibt es auch im asylpolitischen Teil des AfD-Wahlprogramms: „Die AfD wird eine deutliche Kehrtwende in der bisherigen Migrationspolitik einleiten und die Staatsgrenzen wieder kontrollieren. Die Freizügigkeitsregelungen innerhalb der EU bleiben davon unberührt. Einreisen darf künftig nur noch, wem dies erlaubt ist.“ Nicht mehr aufgenommen hat die AfD ihr Konzept einer „Minus-Migration“, das schon 2017 zur Diskussion darüber geführt hatte, wie freiwillig das „Minus“ denn sein solle. Sie verzichtet auf den Begriff und setzt stattdessen auf „Remigration“ – ein Begriff, der eine zweifache Karriere hat: die harmlose und die extremistische.
„Remigration“ – angeblich nur die geltende Rechtslage
Harmlos im Sinne von Rückkehr entsprechend internationaler Konventionen; extremistisch im Sinne einer kulturkämpferischen Restauration ethnischer Homogenität. Im AfD-Wahlprogramm heißt es, „Remigration“ umfasse nur Maßnahmen, „die bereits heute der geltenden Rechtslage entsprechen oder sich jedenfalls mittels verfassungskonformer Gesetzesänderungen umsetzen lassen“. Es ist eine der Stellen, die ganz offensichtlich darauf zielen, sich an die unverfängliche CDU/CSU-Linie anzupassen – quasi als Anerkennung dafür, dass die Union in vielen Punkten wieder Positionen vertritt, mit denen moderate AfDler seit Jahren als die einer „rechten CDU“ für sich werben.
Die AfD strebt allerdings, konform zu ihrer EU-Politik, einen Austritt aus der gemeinsamen Asylpolitik an: „Stattdessen werden wir uns – analog zu Dänemark – im Rahmen eines ,Opt-Out‘ nicht länger an der gemeinsamen Politik der EU im Bereich Asyl, subsidiärer Schutz und vorübergehender Schutz beteiligen.“ Während sie damit nicht nur der EU, sondern auch allen Parteien in Deutschland den Rücken kehrt (inklusive der Union), nimmt sie in anderen Punkten alte und neue Positionen der CDU/CSU auf. Das gilt für die „Umwandlung des individuellen Asylrechts hin zu einer institutionellen Garantie oder einer einfachgesetzlichen Regelung“, aber auch für folgenden Punkt: „Anstoßen sowohl einer Reform der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) als auch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) mit dem Ziel der Anpassung an aktuelle Gegebenheiten seit 2015“.
Genau überlegte Formulierungen
Abgeschwächt hat die AfD im Wahlprogramm auch ihre Haltung zum Islam. Wurden die Muslime in Deutschland 2017 generell noch als „große Gefahr“ beschrieben, heißt es jetzt dort: „Muslime, die sich integrieren und unsere Grundordnung und die Grundrechte anerkennen, sind geschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft. Der politische Islam stellt allerdings in seiner teils gewaltbereiten Ausprägung die größte Gefahr für die christlich-abendländische Kultur in Deutschland dar.“ Einen Kritikpunkt des Verfassungsschutzes hat die AfD allerdings nicht entschärft: „Der Bau von Minaretten und der Muezzinruf sind zu untersagen.“ Darin lässt sich eine Einschränkung der Religionsfreiheit sehen.
Den Formulierungen ist allerdings anzumerken, dass sich die Partei sehr genau überlegt hat, wie sie der Gefahr entgeht, Menschenwürde und Rechtsstaatsprinzip zu verletzen. Ein Verstoß gegen die Menschenwürde wird der AfD vorgeworfen, wenn sie nicht das einzelne Individuum, sondern das „deutsche“ Kollektiv im Sinne einer Abstammungsgemeinschaft als maßgeblich betrachtet und daraus Privilegien „deutscher“ Staatsbürger gegenüber „Passdeutschen“ ableitet – bis hin zum offenen Rassismus. Vor acht Jahren erlaubte sich die AfD noch subtile Andeutungen und Provokationen in dieser Richtung, dieses Mal bleibt es bei „Alice für Deutschland“. Als diskriminierend wurde es damals empfunden, dass die AfD das Kapitel über innere Sicherheit mit einem Kapitel über Ausländerkriminalität startet. Das hat sie beibehalten.
Unerbittlich ist die AfD auch in ihrer Kritik des Parteienstaats geblieben. Weil in ihren Kreisen daraus eine grundsätzliche Kritik am Parlamentarismus abgeleitet und ein Abgleiten in die Diktatur („DDR 2.0“) behauptet wurde, wurden ihr entsprechende Passagen im Grundsatz- und in Wahlprogrammen als Infragestellung des Demokratieprinzips ausgelegt. Ausdrücke wie „Oligarchie“, die sie noch 2017 gebrauchte, spart sie sich jetzt. Auch das von ihr oft bemühte „Parteienkartell“ findet sich nicht im Wahlprogramm. Wohl aber sieht sich die AfD ganz offenbar durch die Ampelkoalition bestätigt: „In unserem Land hat sich jedoch eine politische Klasse herausgebildet, die nicht nur den Umbau des Staates im Sinne ihrer linksgrünen Ideologie verfolgt, sondern gleichzeitig auch die Erhaltung ihrer Macht, ihres Status und ihres materiellen Wohlergehens anstrebt. Sie zerstört die soziale und kulturelle Zukunft unseres Volkes, unsere Wirtschaft und damit unseren Wohlstand.“
Was führt die AfD wirklich im Schilde?
Die basisdemokratische Seite der AfD geht ebenfalls auf ihre Ursprünge zurück und erinnert an die Grünen, als die noch Protestpartei waren. Die AfD will Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild, auch eine Direktwahl des Bundespräsidenten, beides als Ausdruck einer „uneingeschränkten“ Volkssouveränität. Der „Souverän“ müsse stets das letzte Wort haben dürfen. Mit einer parlamentarischen Demokratie lässt sich das nur schwer vereinbaren, aber wird das Demokratieprinzip verletzt?
„Volksabstimmungen auf Bundesebene müssen zentraler Gegenstand jeder Koalitionsverhandlung sein“, schreibt die AfD. Dass sie überhaupt daran denkt, in die Nähe von Koalitionsverhandlungen zu kommen, deutet schon an, worauf ihr Programm zielt. Es ist fast widersinnig: Ihr Markenzeichen, die Migrationspolitik, hat die AfD so angepasst, dass nur die schrillen Töne ihrer Scharfmacher daran erinnern, dass sie vielleicht etwas ganz anderes im Schilde führt und nach nützlichen Idioten Ausschau hält. In allen anderen Politikfeldern ist die AfD dermaßen weit entfernt von allen anderen Parteien, dass weit und breit kein solcher Partner in Sicht sein könnte.
Der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann triumphierte nach dem Abstimmungserfolg zur Migrationspolitik an der Seite von CDU/CSU und FDP im Bundestag: „Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt was Neues, und das führen wir an, das führen die neuen Kräfte an. Das sind die Kräfte von der AfD.“ Um in diese neue Epoche zu gelangen, das ist die Überraschung dieses Wahlkampfs, bedarf es nicht einer neuen Migrationspolitik. Da vertritt die AfD auf dem Papier kaum Neues im Vergleich zu anderen Parteien. Um „was Neues“ zu erreichen, müsste aber alles andere eine ähnliche Wendung wie die Migrationspolitik nehmen. Denn da sucht die Partei die Radikalität, die sie woanders nicht mehr so wie früher ausleben will. Das Wahlprogramm der AfD liest sich deshalb so, als sei sie zur alten weißen Partei geworden: extremistisch überall,wo es ihr nicht als Extremismus ausgelegt wird.







