Gestritten wird dabei weniger über die politischen Konzepte der drei Parteien, die sich erst ineinander verkeilten und dann in schroffen Gegensatz zueinander gerieten, als über die persönliche „Schuldfrage“. War FDP-Chef Christian Lindner in den letzten Koalitionsverhandlungen schon innerlich entschlossen, sie platzen zu lassen? Hatte er dem röchelnden Dreierbündnis gar seit September die Luft abgeschnürt?
Oder gab es, wie der FDP-Vorsitzende nahelegt, auch bei den Sozialdemokraten eine interne Debatte darüber, an welchem Punkt man das Ganze, in Bergmannssprache ausgedrückt, über die Wupper gehen lässt? Dass der Kanzler zumindest in den letzten Verhandlungsrunden mit allem gerechnet hatte, ergab sich aus den Vorbereitungen zu seiner als Wutrede bekannt gewordenen Nachlese am Abend des Koalitionsbruchs.
Nach eigenem Bekunden hatte Olaf Scholz ja aus einem von drei sehr unterschiedlichen Entwürfen auswählen können. Und hatte nicht so mancher, der in den Wochen zuvor vertraulich mit Sozialdemokraten gesprochen hat, vorgerechnet bekommen, wie und wann eine Trennung von den renitenten Liberalen wohl am besten funktionieren könnte?
„Klarer Auftrag, Profil zu zeigen“
Wer sich die Weichenstellungen der vergangenen zwölf Monate noch einmal in Erinnerung ruft, stellt fest, dass hier schwere Züge aufeinander zurollten, deren Lokführer am Ende nur noch die Wucht des Aufpralls steuern konnten. Dabei begann das Jahr, in dem die Koalition crashte, gar nicht so übel. Kurz vor der Winterpause hatten sich die drei Spitzen Scholz, Habeck und Lindner noch einmal zusammengerauft und gemeinsam einen Haushaltskompromiss präsentiert.
Das war schwierig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht das Manövrieren mit Schattenhaushalten für rechtswidrig erklärt und der Koalition damit ihre Geschäftsgrundlage entzogen hatte; bis dahin hatte sie ihre inneren Widersprüche vor allem mit Geld lindern können. Nun musste man sich auf Einsparungen einigen, darunter Subventionskürzungen bei den Bauern. Die Schuldenbremse blieb auf Druck der FDP unangetastet, allerdings bauten SPD und Grüne die Klausel ein, dass für den Fall unvorhersehbarer Veränderungen im Ukrainekrieg die sogenannte Notlage erklärt werden könne, also höhere Schulden zu einem späteren Zeitpunkt erlaubt wären.
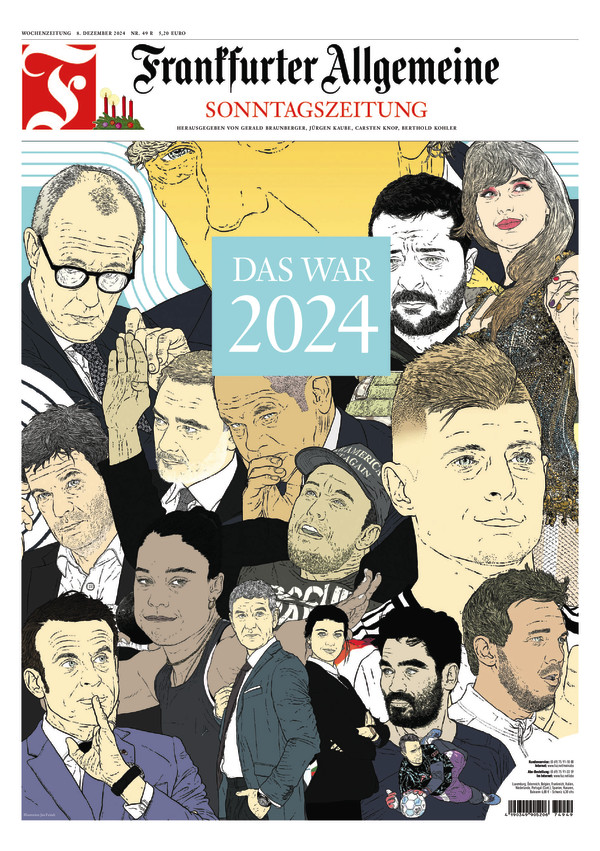
Dieser Text stammt aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Über die Weihnachtszeit musste noch ein bisschen gezittert werden, weil die FDP ihre Mitglieder über einen Austritt aus der Koalition abstimmen ließ, aber der „Lexit“ blieb aus. Am ersten Tag des neuen Jahres teilten die Liberalen mit, dass 52 Prozent für das Bleiben gestimmt hätten. Parteichef Lindner bezeichnete das Ergebnis als „Ausdruck der Verantwortung für Deutschland“, ließ aber schon durchblicken, in welche Richtung es von nun an verstärkt gehen würde: Er sah in dem knappen Votum „den klaren Auftrag, im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen“.

Der Neustart hielt nicht lange an. Schon am 8. Januar begannen die Bauern ihre „Aktionswoche zu Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung“. Es sollten mehrere Wochen daraus werden. Überall im Land hingen Gummistiefel an den Ortsschildern, eine symbolische Drohung, dass die landwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung gefährdet sein könnte. Die Landwirte erhielten viel Unterstützung. Auch laut Umfragen zeigte sich zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Drittel der Wähler mit den Ampelparteien zufrieden, ein Wert, der sich bis zum Ende nicht mehr nennenswert verändern sollte.
Die Koalition gab dem Unmut der Bauern teilweise nach und knüpfte den mühsam, aber auch flüchtig zusammengeschusterten Haushaltskompromiss wieder auf. Das ließ neue Löcher entstehen. Der Eindruck einer kopflosen Regierung verstärkte sich. Im Mai ging noch eines der Zentralprojekte durchs Kabinett, die Rentenreform. Aber als sie kurz darauf im Bundestag debattiert wurde, formulierten FDP-Abgeordnete Bedenken: zu teuer.
Wieder einmal schienen die Liberalen einen schon vereinbarten Kompromiss aus Motiven der Profilierung aufzukündigen, aber es gab auch Gründe, die tiefer reichten. Die Krise der deutschen Wirtschaft wurde immer offensichtlicher, aus Sicht der FDP mussten neue Prioritäten definiert werden. Nicht nur hielt die Rezession an, die Abwanderungstendenzen und Firmenpleiten nahmen zu. Das Wort von der Deindustrialisierung machte die Runde.
Schon im April hatte der Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Börse, Theodor Weimer, einen Eindruck vermittelt, wie weite Teile der Wirtschaft die Lage sahen. In einer Rede, die erst zwei Monate später, nach ihrer Veröffentlichung im Netz, breite Resonanz erzeugte, rechnete er mit der Politik der Regierung ab. Er verortete Deutschland „auf dem Weg zum Entwicklungsland“. Die Investoren liefen davon, so schlecht wie heute sei das Ansehen Deutschlands noch nie gewesen, klagte Weimer vor Wirtschaftsinteressierten in Bayern.
„Bierzelt-Style“
Bei SPD und Grünen wies man die Rede entrüstet als „Bierzelt-Style“ oder sogar als „Verachtung“ demokratisch legitimierter Prozesse zurück. Von Standort-Bashing war die Rede, von einem bewussten Schlechtreden Deutschlands und natürlich von der Gefahr, mit derlei Kritik die AfD zu stärken. Dass nicht nur viele Wirtschaftsvertreter, sondern eine große Mehrheit der Wähler die Situation des Landes nicht mehr so sah wie die Regierung, zeigte sich dann bei den Europawahlen, wo die Ampelparteien historisch schlechte Ergebnisse einfuhren, während die AfD trotz eines chaotischen Wahlkampfs zur zweitstärksten Kraft (nach der Union) aufstieg.
Zusammen erhielten die Ampelparteien nur noch 31 Prozent. Unionschef Friedrich Merz warf Scholz im Bundestag vor, „unfähig und unwillens zur Selbstkritik und zur Korrektur“ zu sein. Statt externe Krisen für das Erstarken von Links- und Rechtsradikalen verantwortlich zu machen, solle er auf die eigene Arbeit blicken: „Sie sind dafür verantwortlich, dass die Probleme in unserem Lande nicht gelöst werden.“
Damit war auch die ungesteuerte Migration gemeint, welche die Koalition seit ihrem Beginn hatte vor sich hin treiben lassen. Inzwischen war die Stimmung im Land umgeschlagen, selbst sozialdemokratische Veteranen wie Sigmar Gabriel riefen zur Umkehr auf. Der öffentliche Druck zwang die Regierung, Grenzkontrollen auszuweiten und Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Aber das Muster des Handelns erinnerte an die Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung: zu wenig, zu spät.
Gescheiterte Gipfel
Ein abermaliger Migrationsgipfel, der nach der Sommerpause einberufen wurde, scheiterte wie die vorangegangenen – diesmal, weil die Koalition nicht auf den Unionsvorschlag einer Zurückweisung an den Grenzen eingehen wollte. Nur die FDP zeigte sich bereit, die Maßnahme mitzutragen. Rumort hatte es bei den Liberalen schon lange, nun öffnete sich auch auf diesem Feld ein für alle sichtbarer Spalt in der Koalition.
Im August war bereits der letzte Haushaltskompromiss zerfallen, zu dem sich die drei Parteien noch kurz vor der Sommerpause durchgerungen hatten. Lindner forderte plötzlich Nachverhandlungen und begründete das mit einem Gutachten, das er selber in Auftrag gegeben hatte. Der Kanzler allerdings las dasselbe Dokument als Bestätigung des vereinbarten Kompromisses. Aus dem Sommerurlaub warf er seinem Minister vor, ein „klares Votum“ von Fachleuten missverstanden zu haben. Dies sei ein „Mysterium“. Die Gereiztheit zwischen den beiden war spätestens jetzt unübersehbar.

Bei den September-Wahlen in Sachsen und Thüringen erlebten die Ampelparteien dann das erwartete Debakel. Die AfD räumte ab, die Sozialdemokraten rutschten auf sieben und sechs Prozent ab, die Grünen flogen aus dem Landtag in Erfurt, die FDP wurde zur Splitterpartei. Nach der Brandenburg-Wahl drei Wochen später, die für Grüne und Liberale ähnlich desaströs verlief, kündigte Lindner einen „Herbst der Entscheidungen“ an und ließ erstmals Zweifel am Verbleib in der Ampel zu. Erste Liberale fragten sich öffentlich, ob die Koalition noch das Jahresende erreichen könne.
Im Oktober sank die Regierung ins Stadium des offenen Gegeneinanderarbeitens. Während sich die negativen Nachrichten aus der Wirtschaft überschlugen, setzten sich die drei Ampelspitzen mit hektischen Aktionsplänen in Szene. Der Kanzler lud zu einem Industriegipfel ein, an dem sein eigener Finanzminister nicht teilnahm. Dieser organisierte einen Gegengipfel, zu dem sich andere Wirtschaftsvertreter versammelten.
Wirtschaftsminister Robert Habeck wiederum überraschte zur selben Zeit mit der Idee eines neuen Investitionsfonds – ein Vorstoß, der in der Koalition nicht abgesprochen war. Widerstreitende Konzepte und spontan entworfene Pläne in Milliardenhöhe schwirrten durch den Raum, als sei ein Leistungskurs Sozialwissenschaften zum lockeren Brainstorming aufgefordert worden. Die Auflösungserscheinungen der Koalition waren nun mit Händen zu greifen. In dieser Zeit entstand auch das umstrittene „D-Day-Papier“ in der FDP-Parteizentrale, das Szenarien für ein Koalitionsende durchspielte, aber angeblich nie die Schreibtische der Parteioberen erreichte.
Am 1. November schlug aber erst mal ein anderes FDP-Papier ein, das rasch als „Scheidungspapier“ bezeichnet wurde. Ähnlich dem historischen „Lambsdorff-Papier“, das mehr als vier Jahrzehnte zuvor das Ende der sozialliberalen Koalition eingeläutet hatte, enthielt das Lindner-Papier die Forderung nach einer „Wirtschaftswende“. Lindner verlangte nicht weniger als eine „teilweise grundlegende Revision politischer Leitentscheidungen“, von Beschlüssen also, welche die eigene Koalition getroffen hatte. Zu diesen gehörte nicht zuletzt die Rentenreform, aber auch die Selbstverpflichtung, schon im Jahr 2045 die sogenannte Klimaneutralität zu erreichen. Lindner wusste, dass die beiden Punkte für seine Koalitionspartner ähnlich unverhandelbar waren wie für ihn eine Reform der Schuldenbremse.
Vor die Wahl gestellt
Zwei Tage später aß er mit Scholz im Kanzleramt zu Abend und stellte ihn vor eine Alternative. Entweder sei der Kanzler bereit, in den anstehenden Verhandlungsrunden über die FDP-Forderungen zur Wirtschaftswende zu sprechen, oder man solle als Koalition gemeinsam Neuwahlen einleiten. Scholz lehnte beides ab und versuchte die nächsten zweieinhalb Tage, in unterschiedlich zusammengesetzten Koalitionsgesprächen, einen anderen Ausweg zu finden. Am Abend des 6. November war dann nichts mehr zu retten. Nun war es der Kanzler, der seinen Minister vor eine Wahl stellte: neuen Schulden zuzustimmen oder aber die Koalition zu verlassen. Lindner verweigerte sich einer Umgehung der Schuldenbremse, worauf Scholz ihm die Entlassung ankündigte.
Die Art des Endes erinnert an den Zusammenbruch der sozialliberalen Koalition im Jahr 1982, aber damals ging es in absehbaren und geordneten Bahnen weiter. Es gab eine andere Kanzlermehrheit im Bundestag, die wenig später in einer Bundestagswahl bestätigt wurde.
Am Ende des Jahres 2024 blicken die Bürger dagegen in einen Horizont nebliger Optionen. Unwahrscheinlich ist nur, dass nach der Wahl die Ampel noch einmal aufgelegt wird. Selbst wenn Scholz’ angekündigte Aufholjagd die SPD über die 20-Prozent-Marke führen sollte, dürfte es für diese Konstellation nicht mehr reichen; und das ist nur der rechnerische Aspekt. Nach den Kabalen der vergangenen Wochen erscheint eine Zusammenarbeit zwischen SPD und FDP auch aus atmosphärischen Gründen unvorstellbar.
Damit dürfte die Ampel als einmaliges paradoxes Experiment in die Geschichte eingehen: Vergeblich wurde versucht, mit den Handschuhen Angela Merkels den von ihr hinterlassenen Scherbenhaufen abzutragen. Die Migrationskrise sollte weiterhin mit Humanitätsfundamentalismus gelöst werden, Investitionsstau und Verteidigungsunfähigkeit mit neuen Schulden, die Belastungen durch die Klima- und Energiewende mit raffinierten Subventionen. Das alte Konzept der Problemlösung durch Konfliktvermeidung scheiterte, auch weil die Probleme gewachsen und die finanziellen Möglichkeiten geschrumpft waren.

In ihrer schwachen Prägekraft erinnert die Ampelzeit an die drei Jahre unter Kanzler Ludwig Erhard, die damals ebenfalls auf viele wie ein Wurmfortsatz einer eigentlich ans Ende gekommenen Ära wirkten. Erst der Wechsel zu Kurt Georg Kiesinger und dem neuen Koalitionspartner SPD setzte Energien frei, um die Rezession mit umfassenden Reformen zu lösen. Gelegentlich wurde Scholz mit dem fast vergessenen Übergangskanzler der ersten großen Koalition verglichen, aber der war zu erfolgreich, um Scholz den Kiesinger unserer Tage zu nennen.
Dass die Ampelkoalition – so wie die Kurzkabinette zwischen 1963 und 1969 – einmal als Brücke zwischen stabilen Regierungsepochen angesehen wird, als Unterbrechung der Normalität, ist unwahrscheinlich. Eher dürfte sich mit dem Ende des Dreierbündnisses die Ära der Unruhe fortsetzen. Als die Übergangsphase zwischen Adenauer und Brandt/Schmidt beendet war, hatte sich der Bundestag kaum verändert. Es gab weiterhin zwei Volksparteien mit jeweils über 40 Prozent und dazu das liberale Zünglein an der Waage.
Heute kann die größte Partei, die Union, auf ein Ergebnis von 30 plus hoffen, während alle anderen unter 20 Prozent landen dürften. Sollte FDP und Linken der Wiedereinzug gelingen, könnten im nächsten Bundestag sieben Fraktionen sitzen, von denen eine der großen, die AfD, als nicht koalitionsfähig betrachtet wird und zwei weitere (BSW und Linke), wenn überhaupt, nur unter Umständen als Juniorpartner infrage kämen.
Zu erwarten sind neue, gewöhnungsbedürftige Konstellationen; die Verabredungen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg geben einen Vorgeschmack. Wohl auch deshalb rücken die Parteien der sogenannten Mitte wieder inhaltlich zusammen; eine mögliche Zusammenarbeit soll nicht unnötig erschwert werden. Merz präsentiert seine Union zwar nach wie vor als Gegenwelt zur Ampel, baut aber unverkennbar Stege.
Das Waffensystem Taurus soll nun nicht mehr innerhalb von 24 Stunden in die Ukraine geliefert werden, die Schuldenbremse ist nicht mehr sakrosankt, von wirtschaftlichen Radikalreformen will er nichts wissen. Auch wenn in seiner Parteizentrale von einer schwarz-gelben Koalition oder gar einer Alleinregierung fabuliert wird – ein Kanzler Merz wird vermutlich eine Regierung führen, in der mindestens einer der linken Ampelpartner wieder auftaucht.
Es fällt auf, dass politische Gespräche schon heute verdächtig oft um die übernächste Bundestagswahl kreisen. Selbstbewusst hat die AfD ein „Projekt 2029“ ausgerufen, also das Ziel, in gut vier Jahren stärkste Partei zu sein. Sie glaubt, dass ihr nichts so sehr helfen würde wie eine graduelle Fortführung der bisherigen Regierungspolitik mit nur leicht verschobenen Farbakzenten.
Drei Jahre Ampel haben die Rechtsaußen-Partei von zehn auf mehr als 18 Prozent katapultiert. Ginge es so weiter, könnten in Deutschland bald französische oder italienische Verhältnisse herrschen. Zumindest einige Mitte-Politiker nehmen das ernst. Schon bevor die Ampel endete, warnte der CDU-Politiker Jens Spahn, dass eine unionsgeführte Koalition „ohne Formelkompromisse“ auskommen müsse. Es sei der „letzte Schuss.“







