Anfang Mai 1986 hatte Autor dieser Zeilen ein unerhörtes Blütenerlebnis. Und das nicht im botanischen Garten oder einem exotischen Tropenland, sondern nahe Oberstaufen im Allgäu. Dort erstrecken sich zahlreiche Wiesen, auf denen üblicherweise Kühe weiden. Zu dieser Jahreszeit hätten sie das saftigste Gras vorgefunden, das man sich vorstellen kann. Allein, es wurde ihnen vorenthalten. Nach der Reaktorhavarie in Tschernobyl am 26. April 1986 war die Radioaktivität auch bis ins Voralpenland gelangt. Das Vieh durfte nicht auf die Weiden, sodass sich dort ein ungeheures Blumenmeer hatte ausbreiten können. Vor allem leuchtete der Löwenzahn.
Der Anblick war auf eine bittersüße Art unvergesslich. Der amerikanische Dichter Walt Whitman beschreibt in seinem bekanntesten Gedicht „When lilacs last in the dooryard bloom’d“ etwas Ähnliches, das er beim Anblick blühenden Flieders empfand. Der erinnerte ihn jeden Frühling aufs Neue an die Trauer um Präsident Abraham Lincoln, der heute vor 160 Jahren bestattet wurde.
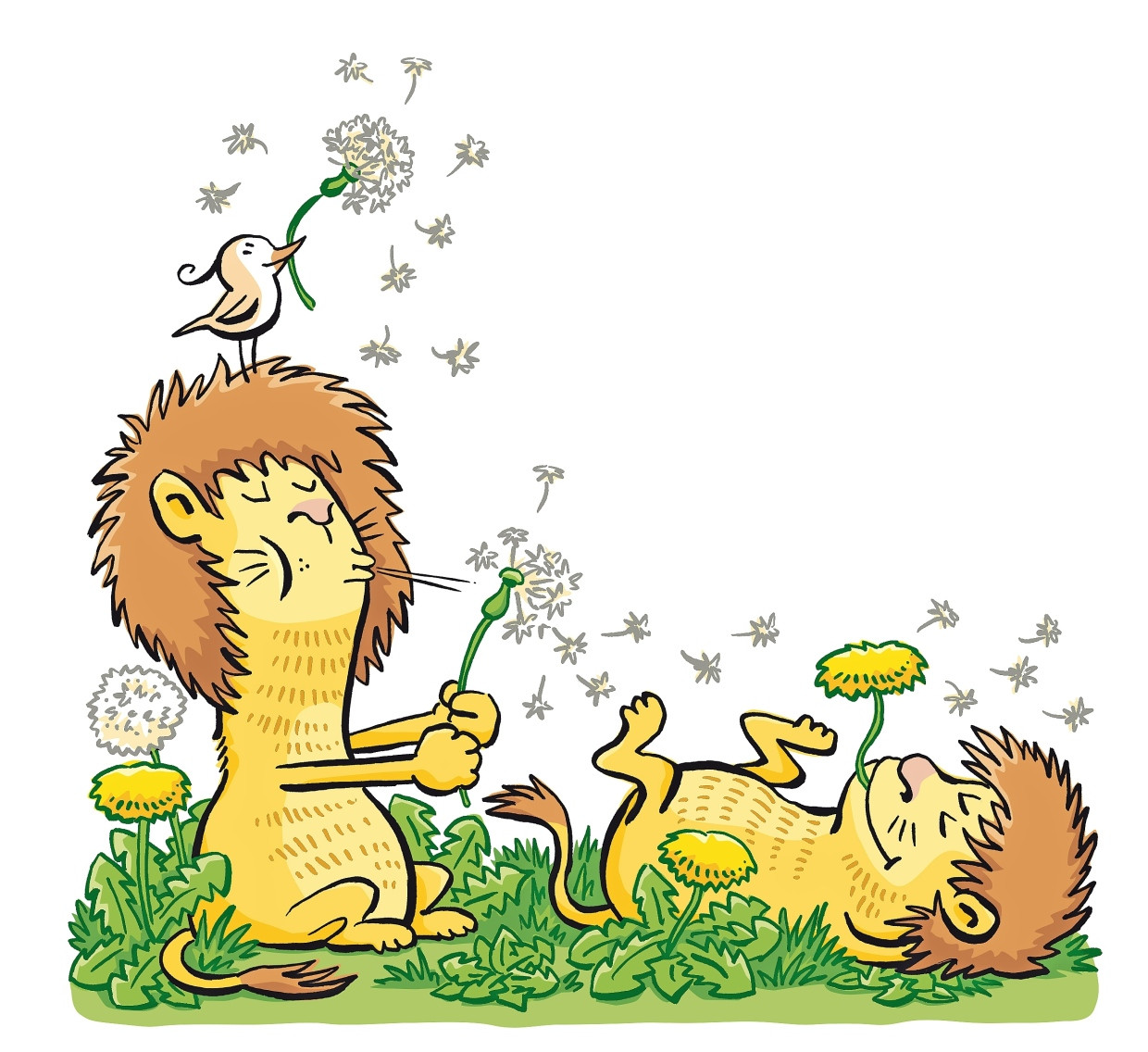
Gärtner stimmt Löwenzahn meist weniger elegisch. Die Korbblütler der Gattung Taraxacum sind die natürlichen Feinde aller Liebhaber gepflegter Rasenflächen. Doch Löwenzahn gedeiht praktisch überall unter einem weiten Spektrum an Temperatur- und Bodenbedingungen. Hinter dieser ökologischen Geschmeidigkeit steckt eine eigentümliche Populationsgenetik: Die Pflanzen vermehren sich mehrheitlich ungeschlechtlich und sammeln dabei schnell Mutationen an, darunter auch am aktuellen Standort besonders vorteilhafte. Dabei können ungeschlechtliche Individuen aber auch geschlechtlich fortpflanzungsfähige Nachkommen haben. Ihre evolutionäre Komplexität macht Taraxacum allerdings auch zu einem Albtraum für Taxonomen, die diese Gattung heute in rund sechzig Sektionen vieler eng verwandter Arten unterteilen. Die Datenbank „Catalogue of Life“ verzeichnet aktuell 2510 benannte Löwenzahnarten.
Zugleich hat man den Eindruck, es gebe von Jahr zu Jahr mehr Löwenzahn. Zumindest langfristig rührt das durchaus an etwas Richtiges: Außer in botanischen Illustrationen hat kein alter Meister seine Blüten je zum zentralen Motiv gemacht. Tatsächlich war Löwenzahn noch in der Neuzeit lange keine so prominente Erscheinung wie heute. Auf den Grund verweist eine mögliche Ableitung seines Gattungsnamens von dem griechischen Verb taráttein, „stören“. Gestörte Naturräume sind sein Revier: Wo Rodungen, intensivierte Landwirtschaft oder überhaupt das Vorrücken der Zivilisation die Fluren vernarbt, da kommt Taraxacum besser zurecht als viele andere Pflanzen.
Doch das Zeitalter des Löwenzahns hat erst begonnen. Im Januar 2017 erschien in dem Fachjournal Weed Science (also „Unkrautwissenschaft“) eine Auswertung von Experimenten mit Löwenzahn, der unter erhöhten CO2-Pegeln kultiviert worden war. Die Pflanzen hatten 83 Prozent mehr Blüten, die jeweils 32 Prozent mehr Samen hervorbrachten, welche wiederum mit höherer Rate auskeimten. „In dem Maße, wie der atmosphärische CO2-Gehalt steigt“, schrieben die Unkrautwissenschaftler in ihrer Veröffentlichung, „könnten sich Verbreitung und Schädlichkeit des Löwenzahns also weiter erhöhen.“
Die tiefgelben Puschel sind also die Wappenblume des Anthropozäns. Da könnte man sich Schlimmeres vorstellen – nicht nur optisch. Löwenzahn liefert Insekten Nektar, ist in allen seinen Teilen essbar, eine altbewährte Medizinalpflanze, und aus manchen Arten kann man sogar Gummi herstellen, dessen Abrieb kein Unwesen als Mikroplastik triebe. Der Löwenzahn macht dem Menschen tatsächlich viel Freude. Und doch …







