Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein“, heißt es in dem Kinderlied, das – wie das zugrunde liegende Grimm’sche Märchen von Hänsel und Gretel – Fragen aufwirft: Ist es misogyn, da es das Klischee der bösen Hexe ins Kannibalistische steigert? Oder im Gegenteil: Untergräbt es das Patriarchat, da es ja Gretel ist, die am Ende die Sache in die Hand nimmt? Wie konnte das Gebäude, in dem sich derart Schreckliches zuträgt, zu einem weihnachtlichen Motiv werden? Und was ist Pfefferkuchen?
Letztere ist eine typische Wessi-Frage. Pfefferkuchen ist die in Ostdeutschland verbreitete Bezeichnung für das, was im Westen meist Lebkuchen heißt. Der Einwand, im Lebkuchen sei doch kein Pfeffer, ist müßig. Erstens war „Pfeffer“ im Mittelalter und früher Neuzeit oft ein Allgemeinbegriff für Gewürze aus Weltgegenden, die damals jenseits der Vorstellungswelt der meisten Europäer lagen.
Und zweitens enthielten die süßen Dauerbackwaren, die man sich kurioserweise oft zu den Fastenzeiten vor Ostern und eben Weihnachten leistete, durchaus Pfeffer. Für das Rezept „To make gingerbrede“ verlangt das englische Kochbuch „Curye on Inglysch“ aus dem 14. Jahrhundert ausdrücklich „longe pepper“, womit der Stangenpfeffer piper longum gemeint ist. Weitere Zutaten sind Gewürznelken, Zucker, rotes Sandelholz (Pterocarpus santalinus) zur Farbgebung, trockenes Weißbrot sowie Honig als Hauptsüßungsmittel – und natürlich Ginger, also Ingwer.
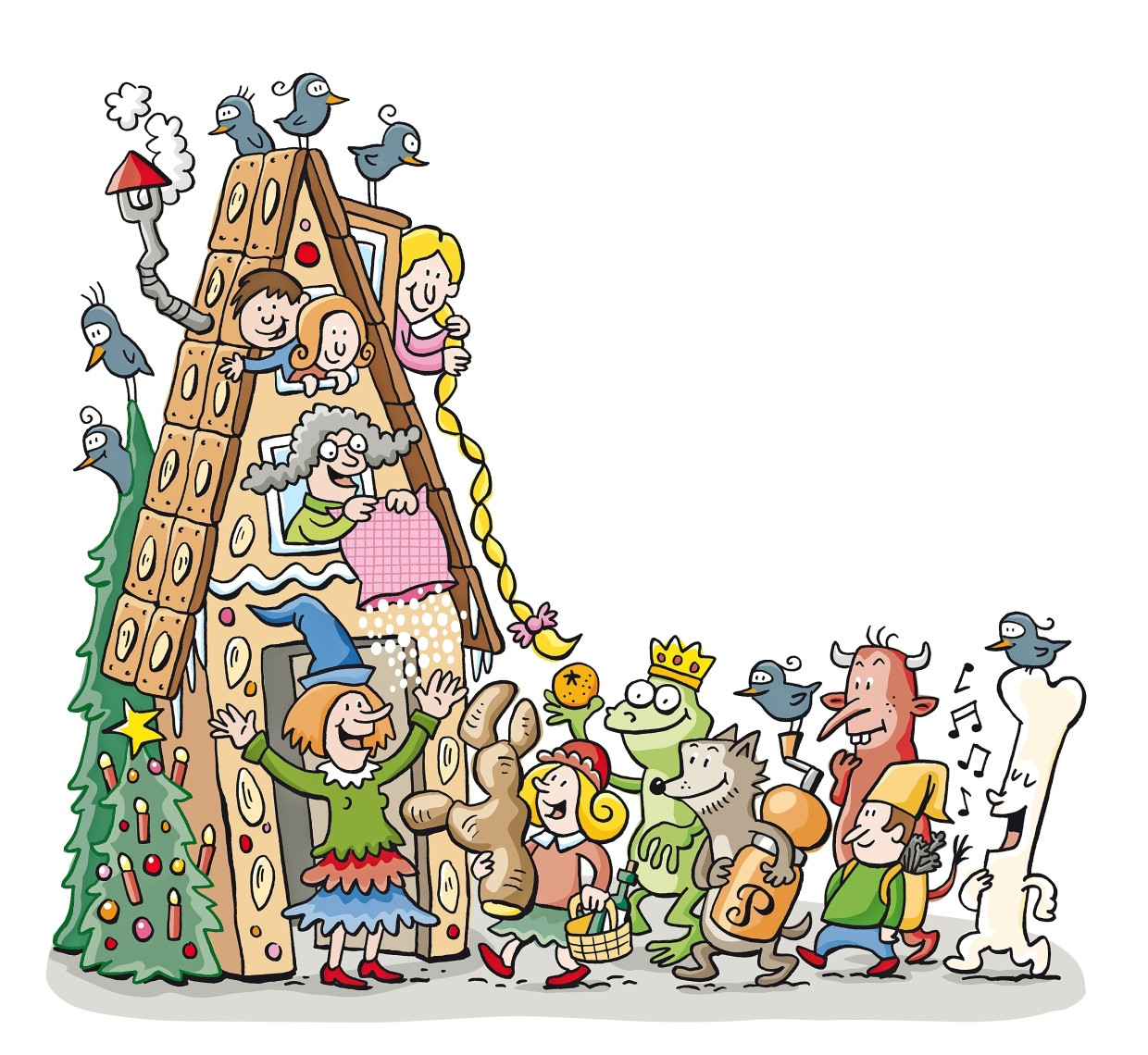
Das scharf-frische Rhizom von Zingiber officinale ist schon so lange ein Genussmittel, dass die Wildform dieser Pflanze nicht mehr bekannt ist. Austronesische Völker verbreiteten sie wohl schon im dritten Jahrtausend vor Christus über Südostasien und später weiter bis nach Madagaskar im Westen und Hawaii im Osten. Ihre Pflanzenordnung, die der Ingwerartigen, beherbergt noch andere prominente Gewächse, darunter die Banane. Und auf der Ebene der Pflanzenfamilie der Ingwergewächse wären da etwa Kurkuma oder Kardamom.
Schriftlich belegt ist der Ingwergenuss zuerst im China des 5. Jahrhunderts vor Christus. 500 Jahre später importierten auch die Römer das Gewürz. Plinius der Ältere erwähnt den Ingwer, glaubt aber, er werde in Arabien angebaut sowie in der Troglodytica, also im Nordosten des heutigen Sudans. Dass er zudem schreibt, die Pflanze würde schnell verrotten, „obgleich sie von solcher Bitterkeit ist“, weckt Zweifel, ob Plinius den „zingiberi“ oder „zimpiberi“ selbst je in frischem Zustand gesehen oder gekostet hat. Immerhin notiert er den Preis: Sechs Denare – mit der Kaufkraft von schätzungsweise 120 Euro – kostete um das Jahr 79 nach Christus das Pfund.
Noch im Mittelalter belief sich der Preis für ein Pfund Ingwer auf den Gegenwert eines lebenden Schafes. Die Lebkuchen aus dem „Curye on Inglysch“ waren folglich ein solches Luxusgut, dass die Idee einer Verwendung im Hausbau nicht nur statische Fragen aufwirft.
Indes, gerade im 13. und 14. Jahrhundert, als den goldenen Zeiten des Hochmittelalters Missernten und Pestepidemien folgten, spiegelten sich Not und Schrecken jener Zeit in dem Traum vom Schlaraffenland: „Mehlkuchen sind die Schindeln alle, von Kirche, Kreuzgang, Kammer, Halle“ liest man etwa in dem Gedicht „Das Land Cokaygne“, das um das Jahr 1300 in Irland entstand. Das Grimm’sche Märchen erkennt die Abgründigkeit frivolen Überflusses, indem es im Pfefferkuchenhaus das Böse wohnen lässt. Gerade zur Weihnachtszeit sollte man ihr nicht verfallen und die Bauteile seines adventlichen Lebkuchenhauses vielleicht nur so dimensionieren, dass man sie nach den Feiertagen auch noch mit Freude verzehren kann.






