Dianna Pierce erinnert sich noch gut an den Tag, als Donald Trump in ihrer Fabrik war. Es war im August 2020, also noch in Trumps erster Amtszeit als US-Präsident. Er kam nach Clyde, einer Kleinstadt in Ohio eine gute Autostunde westlich von Cleveland, wo der Hausgerätehersteller Whirlpool das größte Waschmaschinenwerk auf der Welt betreibt.
Es ist ein sehr Trump-freundliches Revier, schon Stunden vor seiner Ankunft stellten sich Menschen auf die Straße, um ihm auf dem Weg zur Fabrik zuzujubeln. Er schaute sich die Produktionslinie 5 an, wo Frontlader gebaut werden, und setzte seine Unterschrift auf eine der Maschinen. „Es war ziemlich aufregend, ihn hier zu haben,“ sagt Pierce, die seit 41 Jahren in der Fabrik arbeitet.
Ihre ebenfalls hier beschäftigte Tochter war sogar kurz mit ihm auf der Bühne und erzählte von den „endlosen Chancen“, die das Werk biete. Trump schwärmte in seiner Rede davon, wie schön die Waschmaschinen seien, und er lobte sich selbst als „Präsident, der für die amerikanischen Arbeiter kämpft“. Er nannte Whirlpool „ein leuchtendes Beispiel dafür, was harte Handelspolitik und kluge Zölle bringen können“.
Musterbeispiel für Donald Trumps „America First“
Das Werk von Whirlpool in Clyde ist ganz nach dem Geschmack der Präsidenten. Ein amerikanischer Traditionskonzern fertigt hier Produkte, die er zum größten Teil in seinem Heimatmarkt verkauft, und setzt dabei auch Material ein, das er überwiegend in den USA bezieht. Es ist ein Musterbeispiel für Trumps „America First“-Weltanschauung, die sich in seiner zweiten Amtszeit in einer noch aggressiveren Zollpolitik äußert als in der ersten.
Trump alarmiert damit weite Teile der Wirtschaft, aber offenbar nicht Whirlpool. Vorstandschef Marc Bitzer sieht sein Unternehmen als „Nettogewinner“ der gegenwärtigen Handelspolitik, und er sagt, er sei „pro Zölle“ – zumindest was seine Branche angeht. Das ist aus seinem Munde umso bemerkenswerter, weil er als gebürtiger Deutscher gewissermaßen selbst Globalisierung verkörpert.
Der 60 Jahre alte Manager stammt aus der Nähe von Tübingen und ist einer der wenigen Deutschen an der Spitze eines großen amerikanischen Konzerns. Er beschreibt seine Haltung zu Zöllen als Ergebnis eines Lernprozesses. Studienwissen über negative makroökonomische Effekte von Zöllen sei das eine, aber die Praxis sei komplizierter, denn nicht jeder spiele nach denselben Regeln. „Im Laufe der Karriere stellt man fest, dass völlig freier und offener Handel nicht existiert.“
Das Zollgeschehen nicht dem Zufall überlassen
Hausgeräte haben in Trumps Handelspolitik öfters eine Rolle gespielt. In seiner ersten Amtszeit verhängte er Zölle auf importierte Waschmaschinen. Erst vor wenigen Wochen kündigte seine Regierung an, die Einfuhrzölle auf Stahl von 50 Prozent auch auf Waschmaschinen und andere Hausgeräte auszuweiten, in denen viel Stahl verarbeitet wird.
In beiden Fällen kam das dem Unternehmen zugute und ging zulasten ausländischer Wettbewerber. Whirlpool überlässt das Zollgeschehen keineswegs dem Zufall, sondern versucht, es mit energischer Lobbyarbeit zu beeinflussen.
Bevor 2018 die Waschmaschinenzölle verhängt wurden, fuhren um die 150 Mitarbeiter aus Clyde mit Bussen nach Washington. Bitzer sagt, er sei selbst „recht oft“ in der Hauptstadt und treffe sich dort mit ranghohen Regierungsmitgliedern, etwa dem Wirtschaftsminister Howard Lutnick, dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer und diversen Senatoren. Als wichtiger einheimischer Hersteller von Produkten, die jeder kenne, sei Whirlpool so etwas wie ein „Aushängeschild“: „Wir spüren viel Bereitschaft in Washington, sich mit uns zu treffen und uns zuzuhören.“
Vom Berater zum Vorstandschef
Bitzer hat heute neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Geboren ist er in der schwäbischen Kleinstadt Balingen, aufgewachsen zum Teil in der Schweiz. Er studierte Wirtschaft an der Universität St. Gallen und erwarb dort auch seinen Doktortitel.
Ursprünglich wollte er in den Textilbetrieb seiner Familie, der dann aber verkauft wurde. Stattdessen wurde er Berater bei der Boston Consulting Group in München und Toronto. Whirlpool war ein Kunde und warb ihn 1999 ab. Seine Karriere begann in der italienischen Tochtergesellschaft, wo er für die deutsche Hausgerätemarke Bauknecht zuständig war, die damals noch zum Konzern gehörte.
Er arbeitete sich zum Chef des Europageschäfts nach oben, 2009 übernahm er die Verantwortung für Whirlpools amerikanischen Heimatmarkt. Vorstandschef ist er seit 2017. Neben seiner Aufgabe sitzt er auch im Aufsichtsrat des deutschen Autoherstellers BMW. Bauknecht wurde im vergangenen Jahr zusammen mit anderen europäischen Marken mehrheitlich verkauft.
Die Fabrik gehört zur Identität
Vor dem Whirlpool-Werk in Clyde wehen amerikanische Flaggen. Bitzer sagt, es gebe ihm ein gutes Gefühl, dass die meisten seiner Produkte für den US-Markt auch „Made in USA“ seien. Die Fabrik ist in dieser ländlichen Region von überragender Bedeutung und der mit Abstand größte Arbeitgeber. Rund 2500 Menschen sind hier beschäftigt, ganz Clyde hat weniger als 6500 Einwohner.
Es ist die Art von Betrieb, in dem Familien über Generationen hinweg beschäftigt sind, und wer einmal eingestellt wird, geht üblicherweise nicht so schnell wieder. Im Schnitt sind die Mitarbeiter in Clyde seit 15 Jahren hier. Viele in der Belegschaft sehen die Fabrik als ihre Identität. Dianna Pierce nennt sie ihr „Zuhause“ und erzählt, wie gern sie ihre Sweatshirts mit Whirlpool-Logo auch außerhalb des Werks trägt, etwa wenn sie zu Baseballspielen geht. „Unser Blut ist blau“, sagt sie – so wie die inoffizielle Firmenfarbe. Pierce achtet sogar bei der Auswahl von Ferienwohnungen darauf, ob sie Whirlpool-Geräte haben.
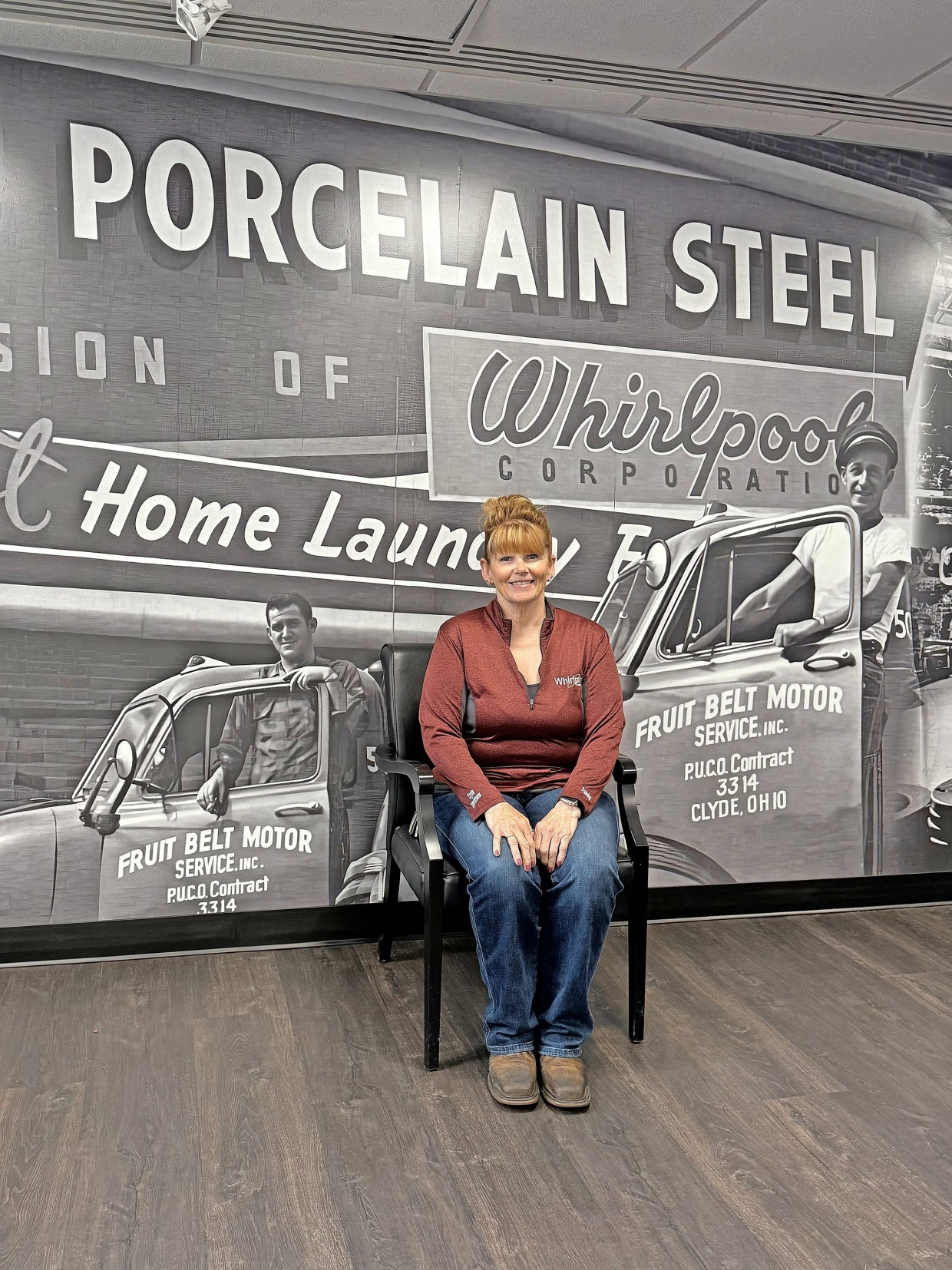
Die Fabrik ist so groß wie 30 Fußballfelder. Unter ihr verläuft ein Bach, der Raccoon Creek, und ab und zu verirrt sich von dort eine Schildkröte in die Hallen. Der Standort ist älter als Whirlpool selbst. 1880 wurden hier Kirchenorgeln gebaut, später diverse andere Produkte wie Spiegel, Uhren, Fahrräder und Lastwagen. Whirlpool kaufte das Werk 1952. Heute werden hier ausschließlich Waschmaschinen produziert, rund eine Stunde südlich betreibt der Konzern eine Fabrik für Wäschetrockner, insgesamt hat er in den USA zehn Fertigungsstätten.
Mehr als 40 Kilometer Förderbänder
In Clyde läuft alle zehn Sekunden eine Waschmaschine vom Band, die jährliche Kapazität liegt bei bis zu 6,4 Millionen Geräten. Drei Viertel der Produktionsmengen entfallen auf Toplader, die in den USA beliebter sind als Frontlader. Mehr als 40 Kilometer Förderbänder winden sich durch die Produktionshallen, teilweise an der Decke.
Werksleiter Ryan Deland nennt sie „Super-Highways“. Unmengen von Bauteilen wie Wäschetrommeln oder Laugenbehälter bewegen sich in schnellem Tempo auf den Bändern voran, und obwohl es nach viel mehr aussieht, sind immer nur so viele von ihnen in der Halle, dass sie für die nächsten zwei bis drei Stunden Produktion reichen.

Deland beschreibt das Werk als „vertikal integriert“, auch viele der Komponenten für die Maschinen werden hier gefertigt. In einem Produktionsbereich stehen große Rollen mit Stahl, der zu Wäschetrommeln verarbeitet wird. Die Fertigung ist nicht hoch automatisiert, aber für einige Arbeitsschritte werden Roboter eingesetzt, manchmal stehen Roboter zwischen zwei Menschen am Band.
Die Produktion läuft im Zwei-Schicht-Betrieb, morgens von 6 bis 14 Uhr und nachts von 22 bis 6 Uhr. Eine Nachmittagsschicht gibt es nicht. Deland erzählt, Mitarbeitern mit Kindern sei die Nachtschicht lieber, damit sie nachmittags Zeit mit ihrer Familie verbringen können.
Wertschätzung für Produkte, die man anfassen kann
Donald Trump will mit seinen Zöllen die heimische verarbeitende Industrie stärken und damit den Wandel zu einer Dienstleistungsgesellschaft bremsen, der sich seit vielen Jahren in den USA und anderen westlichen Ländern vollzieht. Whirlpool-Chef Bitzer kann diesen Gedanken im Grundsatz nachvollziehen, nicht nur weil er persönlich eine besondere Wertschätzung für Produkte hat, die man anfassen kann.
„Eine Gesellschaft ohne jegliche Industrie fühlt sich für mich sehr leer an“, sagt er. Die Vorstellung, sich allein auf Dienstleistungen auszurichten, findet er „traurig“. Zwar lasse sich darüber diskutieren, wie hoch der Anteil der verarbeitenden Industrie am Bruttoinlandsprodukt idealerweise sein sollte, aber würde er auf null sinken, wäre das „gefährlich“. Auch weil man damit riskiere, eines Tages festzustellen, dringend Dinge zu brauchen, aus deren Produktion man sich zurückgezogen habe. „Das sehen wir im Moment bei Seltenen Erden.“

Trumps Vision für die amerikanische Industrie reicht freilich sehr weit, er bedrängt auch Apple, seine iPhones statt in Asien in den USA zu produzieren. Für Bitzer hängt es stark von der Produktkategorie ab, wie sinnvoll heimische Fertigung ist. „Jede Branche tickt anders, man kann das nicht über einen Kamm scheren.“ Als schweres und sperriges Produkt böten sich Geräte wie Waschmaschinen besonders dafür an, nahe am Kunden hergestellt zu werden, Transport sei ein erheblicher Kostenfaktor. Außerdem könne Whirlpool die Mehrheit seiner Rohmaterialien und Bauteile auf dem Heimatmarkt einkaufen, das sei nicht in allen Industrien der Fall.
Wettbewerber kündigen Rückverlagerungen an
Auch Wettbewerber sehen Vorteile einer Produktion in den USA. GE Appliances, einst eine Tochtergesellschaft des Traditionskonzerns General Electric und heute ein Teil der chinesischen Haier-Gruppe, kündigte vor wenigen Wochen an, die Produktion mehrerer Waschmaschinenmodelle von China in die USA zurückzuverlagern. Das soll 800 Arbeitsplätze schaffen.
Als Trump 2018 Importzölle für Waschmaschinen verhängte, zielte das vor allem auf Whirlpools koreanische Konkurrenten Samsung und LG. Ihnen hatten die Amerikaner seit Jahren Dumpingpraktiken vorgeworfen. Dabei hätten sie ihre Produktion immer wieder verlagert, um Antidumpingzölle zu umgehen, die noch unter Trumps Vorgänger Barack Obama für einzelne Länder eingeführt worden waren – erst von Südkorea und Mexiko nach China, dann weiter nach Thailand und Vietnam. Die unter Trump beschlossenen Zölle galten länderübergreifend und waren erst auf drei Jahre angesetzt, daraus wurden dann fünf.
Inwiefern sie ihren Zweck erfüllt haben, ist nicht ganz unumstritten. Samsung und LG eröffneten angesichts drohender Zölle erstmals Waschmaschinenfabriken in den USA, was nach ihren Angaben 1600 Arbeitsplätze brachte, Whirlpool versprach 200 neue Vollzeitstellen in Clyde. Nach einer 2019 veröffentlichten Studie von Ökonomen der University of Chicago und der Federal Reserve hatte das aber einen hohen Preis, den weitgehend amerikanische Verbraucher zahlten.
Die Preise für Waschmaschinen stiegen demnach um 12 Prozent, und sogar Wäschetrockner, für die gar keine Zölle anfielen, wurden um 12 Prozent teurer. Wie die Ökonomen vorrechnen, kosteten die Waschmaschinenzölle Amerikaner aufs Jahr hochgerechnet 1,5 Milliarden Dollar – bei im Vergleich dazu recht bescheidenen Zolleinnahmen für die US-Regierung von 82 Millionen Dollar. Jeder neue Arbeitsplatz habe somit mehr als 800.000 Dollar gekostet.
„Die Zölle haben funktioniert“
Whirlpool-Chef Bitzer hält dagegen: „Die Zölle haben funktioniert.“ Waschmaschinen seien nur vorübergehend teurer gewesen, während die koreanischen Wettbewerber ihre Produktionskapazitäten in den USA hochfuhren. Danach seien die Preise inflationsbereinigt schnell wieder unter das Niveau vor Einführung der Zölle gefallen. Auch zwischenzeitliche Preiserhöhungen inmitten der Corona-Krise seien nicht von Dauer gewesen. Heute seien Waschmaschinen billiger als vor 15 Jahren. „Von wie vielen anderen Produkten kann man das sagen?“
In jüngster Zeit machten Bitzer einige andere Nachteile gegenüber der asiatischen Konkurrenz Sorgen, die er „Schlupflöcher“ in der gegenwärtigen Zollpolitik und „unfair“ nennt. Vor allem geht es dabei um Stahl, das wichtigste Rohmaterial für Hausgeräte. In jeder Whirlpool-Waschmaschine stecken rund 45 Kilogramm Stahl, das ist die Hälfte des Gesamtgewichts. Whirlpool verwendet in seiner US-Produktion fast ausschließlich amerikanischen Stahl, und der ist Bitzer zufolge zwei- bis dreimal so teuer wie chinesischer, der in asiatischen Werken der Konkurrenz zum Einsatz kommt.
Kostennachteil von 50 Dollar je Maschine
Das entspreche einem Kostennachteil von rund 50 Dollar je Maschine, mehr als die Lohnkosten für die Mitarbeiter in Clyde, die sie bauen. Dazu kommen noch 20 Dollar für einige Komponenten wie Motoren, die Whirlpool im Ausland zukaufen muss und auf die in den USA ein Zoll anfällt. Dieses Handicap gibt es schon seit einiger Zeit, es ist dem Unternehmen zufolge aber in den vergangenen Monaten noch gravierender geworden, weil die asiatischen Wettbewerber in Erwartung neuer Zölle ihre Exporte in die USA drastisch aufgestockt und damit Lagerbestände angesammelt haben.
Im Juni half die Trump-Regierung Whirlpool zumindest zum Teil aus dieser Klemme. Sie entschied, dass die Einfuhrzölle auf Stahl, die erst kurz zuvor auf 50 Prozent verdoppelt wurden, fortan nicht mehr nur für Rohmaterial gelten, sondern auch für Stahl, der in bestimmten Hausgeräten verwendet wird, darunter Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke.
Für Whirlpool macht das einen gewaltigen Unterschied. Das Unternehmen schätzt, damit rund die Hälfte des bisherigen Kostenunterschieds von 50 Dollar je Maschine bei Stahl wettmachen zu können. Und da es sich nun in einer besseren Ausgangsposition sieht, verspricht es im Gegenzug zusätzliche Investitionen und „erheblich mehr Arbeitsplätze“ in den USA.
Bitzer gibt zu, bisweilen habe er sich Gedanken darüber gemacht, Produktionskapazitäten ins Ausland zu verlagern, um einige der Kostennachteile gegenüber der Konkurrenz auszugleichen. Aber unter dem Strich spreche mehr dafür, in den USA zu bleiben. Zölle seien ein zusätzliches Argument, da von ihnen letztlich die einheimischen Hersteller profitierten. Und jenseits aller betriebswirtschaftlichen Kalkulation fühle sich Whirlpool an seinen US-Standorten wie in Clyde auch tief verwurzelt. „Das ist hier nicht nur eine kalte Fabrik.“
Die Handelspolitik wird offenbar von den Mitarbeitern in Clyde aufmerksam verfolgt, Werksleiter Deland sagt, die Zolldebatten seien auch innerhalb der Belegschaft ein Thema. Aber seine Kollegen und er wollten sich nicht allzu sehr damit aufhalten, über unfaire Bedingungen zu klagen. „Wenn wir uns als Opfer sehen, haben wir schon verloren.“
Deland sagt, er wolle sich auf die Dinge konzentrieren, die er beeinflussen könne, und das bedeute vor allem, „die bestmöglichen Produkte mit maximaler Effizienz zu bauen“. Politische Haltungen hätten im Hintergrund zu bleiben. „Wir wollen unsere Waschmaschinen an Republikaner und Demokraten verkaufen.“







