Vor 39 Jahren veröffentlichte der am 28. Mai verstorbene kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong’o seine Essaysammlung „Decolonizing the Mind“. Seine These war, dass das Leben unter der Kolonialherrschaft bei den Kolonisierten Denkgewohnheiten hervorgebracht habe, die überwunden werden müssten. Ehemals kolonisierte Menschen, so argumentierte er, sollten sich in ihrer eigenen Sprache ausdrücken, nicht in der Sprache ihrer Kolonialherren. Er selbst hatte beschlossen, Theaterstücke in seiner Muttersprache Kikuyu zu schreiben und aufzuführen, und musste dafür teuer bezahlen. Obwohl er bereits in seinen englischsprachigen Romanen die kenianische Elite für ihre Kollaboration mit den Kolonialherren und die spätere Aufrechterhaltung der kolonialen Ungleichheiten kritisiert hatte, wurde er erst Zielscheibe staatlicher Repression, als er begann, in Kikuyu zu publizieren. Ngugi landete für fast ein Jahr im Gefängnis. Kenia hatte damals offensichtlich noch eine Menge Dekolonisierungsarbeit vor sich.
Was wird erreicht, fragt der New Yorker Historiker Frederick Cooper in einem soeben vorab veröffentlichten Aufsatz mit dem Titel „Decolonizing Decolonization“ in der Zeitschrift „Comparative Studies in Society and History“, wenn man Ngugis Aufruf auf eine Vielzahl von Bereichen ausweitet: das Museum, die Wissenschaft, die Universität, den Lehrplan, die Ernährung, den Körper, den Tourismus, die Musik, das Internet, die Geowissenschaften, die Avantgarde? Die Aufforderung, zu „dekolonisieren“, habe Kraft als Metapher für den Kampf gegen extreme Formen von Vorurteilen und Unterdrückung. Aber als Historiker, der unter Verwendung des Begriffs über die Dekolonisierung im wörtlichsten Sinne geschrieben hat – das Ende der Kolonialherrschaft über Gebiete, die einst Teil europäischer Imperien waren –, fürchtet Cooper, dass die massive Ausweitung des Begriffs ebenso viel verdeckt wie enthüllt. Erweitert oder verwässert der Ruf „Dekolonisiert das!“ die Bedeutung der Dekolonisation?
Die förmliche Verfassung und die Tatsachen der Macht
Aus einer Welt von fünfzig Staaten und untergeordneten Gebieten wurde eine Welt von fast zweihundert Staaten, die theoretisch rechtlich gleichgestellt sind und sich gegenseitig formal anerkennen. Dieser Prozess ist inzwischen von der Wissenschaft ausführlich untersucht worden. Doch wenn das Anliegen der antikolonialen Aktivisten darin bestand, die Extreme der globalen Ungleichheit zu beseitigen, so ist dieses Ziel noch in weiter Ferne. Cooper zitiert aus einem jüngeren Bericht von Wirtschaftswissenschaftlern um Thomas Piketty: „Die globalen Ungleichheiten scheinen heute so groß zu sein wie auf dem Höhepunkt des westlichen Imperialismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts.“
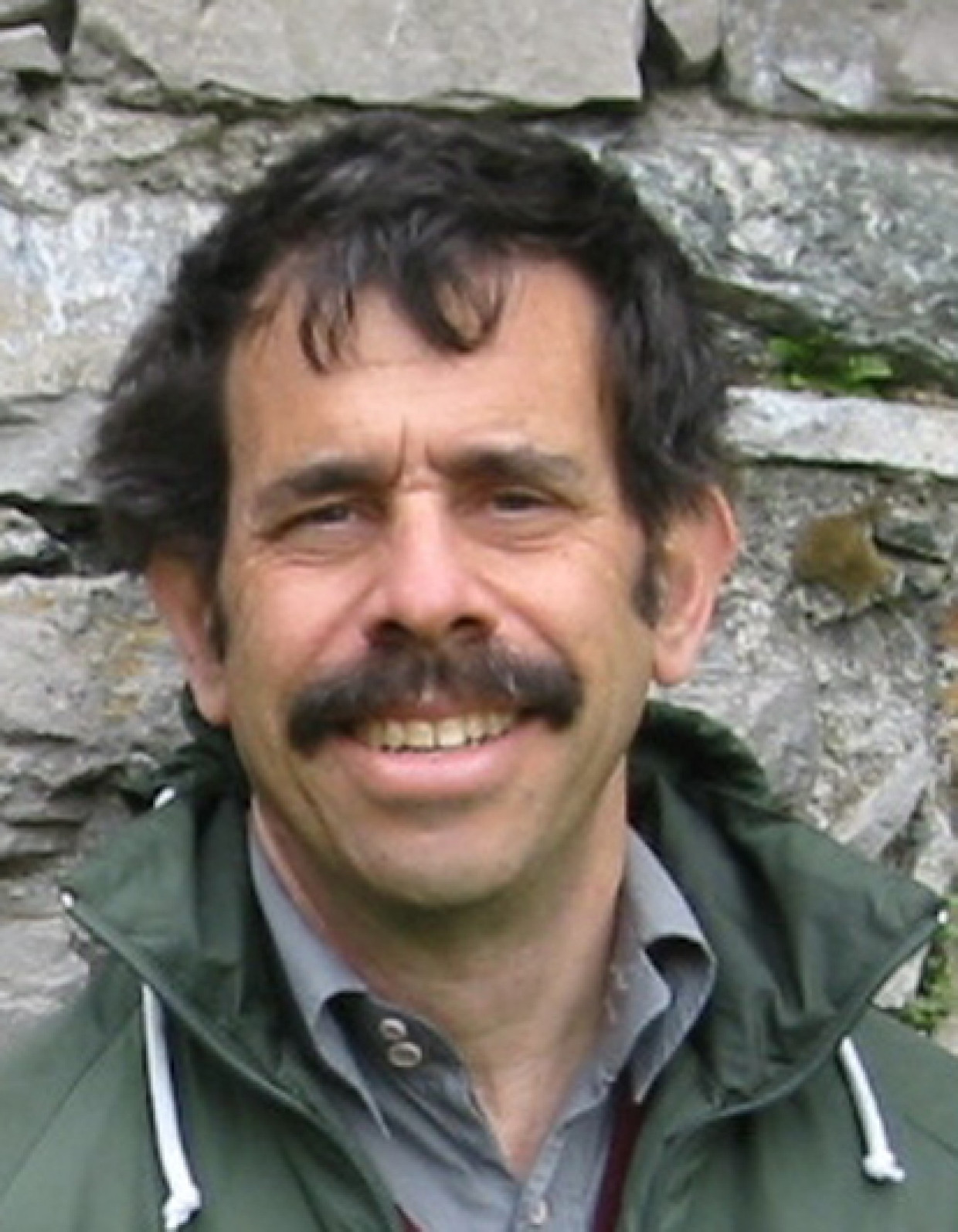
Eine Erklärung für die Popularität der Forderung, zu „dekolonisieren“, sieht Cooper darin, dass dieser Appell den Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen formalen Strukturen und der tatsächlichen Ausübung von Macht lenkt. Für manche Menschen in Europa und Nordamerika sei die Beschwörung der Dekolonisation eine Antwort auf die Frage: Warum fühlen sich so viele Menschen, wenn doch alle angeblich frei und gleich sind, an den Rand gedrängt, diskriminiert und unfähig, in der Welt zu handeln? Für Menschen in ehemaligen Kolonien sei die Behauptung, dass wir uns immer noch dekolonisieren müssen, eine Antwort auf die Frage: Warum sind wir, wenn es unsere Unterdrücker nicht mehr gibt, in unseren eigenen Ländern immer noch arm und machtlos und werden im Rest der Welt verachtet?
Dies sind, schreibt Cooper, wichtige, menschliche und tragische Fragen. Aber wie weit bringt uns die Antwort „dekolonisieren“? Der Verweis auf das Koloniale unterstreiche, dass Machtlosigkeit, Armut, Sexismus, Rassismus und kulturelle Verunglimpfung keine inhärenten Bedingungen des menschlichen Daseins sind, sondern historisch konstruiert und gewachsen. „Aber wenn wir die Machtverhältnisse ändern wollen, müssen wir sie in ihrer ganzen Komplexität verstehen.“ Die Herrschenden und die Opposition innerhalb von Staaten handeln in einer Matrix von Möglichkeiten und Zwängen, aber durch ihre Handlungen verändern sie diese Matrix. Man solle sich eher mit der Eröffnung und Schließung von Alternativen als mit Unvermeidbarkeiten befassen, sich mehr auf historische Verläufe als auf „Vermächtnisse“ des Kolonialismus konzentrieren.
Dass der Kolonialismus aufhörte, eine legitime Form der politischen Organisation zu sein, war das Ergebnis harter und vielfältiger Anstrengungen und Opfer. Wenn Menschen versuchen, die heutige Welt zu verändern, greifen sie auf eine Vielzahl von Vergangenheiten, Visionen und Möglichkeiten zurück, sich in Gesellschaft und Politik zu lokalisieren. Für jene, die nun alles und jeden dekolonisieren wollen, hält Cooper einen schlichten Rat bereit. Die wichtigste Lehre für die Zukunft, die sich aus dem Blick auf die Geschichte der Dekolonisation ergibt, sei, dass sie stattgefunden hat. Was einst eine ferne Möglichkeit war, ohne dass es einen klaren Weg in diese Richtung gab, wurde zur Realität und veränderte die Vorstellungswelt der Menschen ebenso wie die Möglichkeiten und Zwänge, denen sie sich gegenübersahen.







