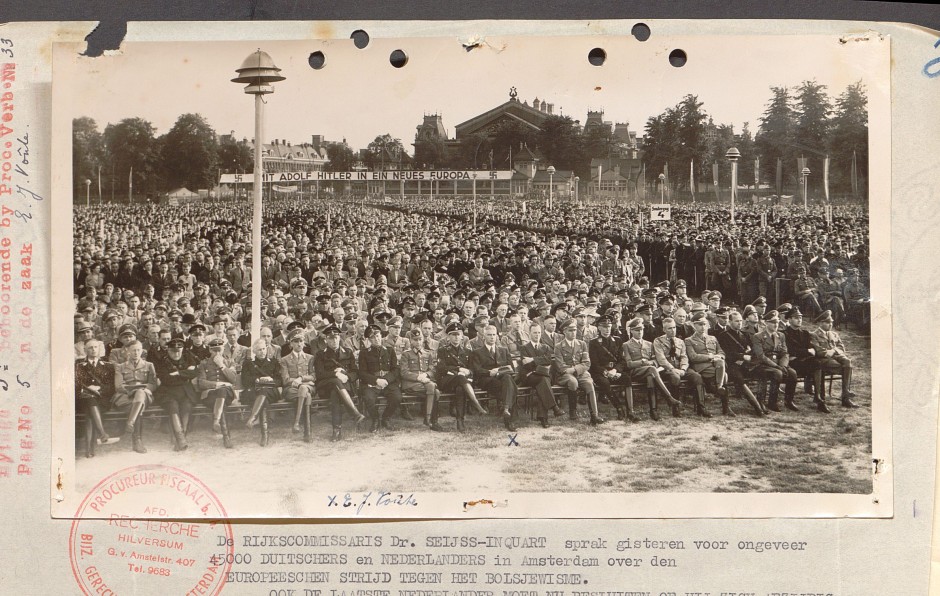
Wie ein Puzzle hat sich alles zusammengefügt, als Michael Schuling die Akte seiner Großmutter im Nationalarchiv in Den Haag vor sich liegen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon lange verstorben, genauso wie ihr Sohn, Schulings Vater. Aber er hatte noch offene Fragen zu seinen Vorfahren, vor allem zu seinem Großvater, einem Soldaten der Wehrmacht. Dieser kam mit den deutschen Besatzern 1940 in die Niederlande – und soll im gleichen Jahr noch seine Großmutter vergewaltigt haben.
Schuling hoffte, dass er durch die Dokumente aus dem Zentralarchiv Sonderjustizwesen – dem größten Kriegsarchiv der Niederlande – mehr herausfinden kann. Denn ihm kamen Zweifel an der Geschichte auf, nachdem seine Mutter Fotos des deutschen Soldaten in der Wohnung der Großmutter gefunden hatte. „Sie dachte, wenn sie sexuell missbraucht wurde, sollte man das nicht in einer Fotobox aufbewahren“, berichtet Schuling Jahre später im Gespräch mit der F.A.Z.
Das abgekürzt CABR genannte Archiv bestätigte, was Schuling schon zuvor vermutete, seine Großmutter aber immer verneint hatte: Es war keine Vergewaltigung, sondern eine Liebesbeziehung. Nach der Befreiung aus der deutschen Besatzung war eine solche mit einem Wehrmachtssoldaten viel schlimmer als eine Vergewaltigung angesehen. „Ich glaube, dass meine Großmutter nicht wollte, dass Menschen herausfinden, was wirklich passiert ist“, sagt der 52 Jahre alte Schuling. Bis zu ihrem Tod habe sie gelogen, weil sie sich geschämt habe.
Über die Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs würden viele schweigen, sagt Anne Marthe van der Bles, Forscherin am ARQ Nationalen Zentrum für Psychotraumata. „In den Niederlanden betrachten wir diese Geschichte in der Regel sehr binär als schwarz-weiß, entweder gut oder schlecht.“ Die einen hätten auf der richtigen Seite gestanden, die anderen auf der falschen. Aber um zu verstehen, was in der Zeit passiert sei, müsse man darüber sprechen, meint van der Bles – und den Schicksalen beider Seiten zuhören.
Das Nationalarchiv hat diese Debatte in den Niederlanden nun angestoßen: Die Prozessakten von 425.000 verurteilten sowie mutmaßlichen Kollaborateuren mit den Nationalsozialisten sollen digitalisiert veröffentlicht werden.
Manche sorgen sich vor freien Daten
Aktuell kann man nur nach einem aufwendigen Registrierungsprozess in Den Haag nach einer Person innerhalb der CABR-Dokumente suchen, mit der man entweder verwandt ist oder deren Akte relevant für eigenen Recherchearbeiten sind. Künftig soll mit der Onlineplattform „Oorlog voor der Rechter“ – auf Deutsch „Der Krieg vor Gericht“ – jeder das vollständige Archiv von einem Computer aus durchsuchen können. So kann nach Familiennamen oder Ortschaften gefiltert werden. Auch Namen von jüdischen Opfern oder Widerstandskämpfern werden so zugänglich. Und zahlreiche Wehrmachtsoldaten werden erwähnt.
Schuling fand durch die Prozessakten des CABR den Namen seines Großvaters heraus. Die Behörden ermittelten nach dem Zweiten Weltkrieg wegen mutmaßlicher Kollaboration gegen seine Großmutter. Für eine gewisse Zeit wurde sie deswegen auch interniert, sein Vater hat mit drei Jahren in einem Kinderhaus gelebt. In der Familie fiel laut Schuling darüber nie ein Wort. Als er seiner Tante, die Halbschwester seines Vaters und Tochter eines gefallenen niederländischen Soldaten, erzählte, was er herausgefunden hat, sei sie sauer gewesen. „Ich wollte transparent sein, damit wir etwas aus den Dokumenten lernen können“, sagt Schuling. Auch dafür engagiert er sich bei „Werkgroep Herkenning“, einer Stiftung, die Nachkommen von Eltern und Großeltern in den Niederlanden hilft, die in den Jahren zwischen 1940 und 1945 auf der Seite der Besatzungstruppen gestanden haben. Es brauche mehr Wissen und Bildung über diese Zeit, sagt Schuling.
Aber so sehen es längst nicht alle. Einige machen sich Sorgen, was die frei zugänglichen Daten über ihre Vorfahren verursachen können. Immerhin wurde die große Mehrheit der gelisteten Personen im CABR nie verurteilt, einige Familien wissen gar nicht erst von den Ermittlungen gegen ihre in der Regel bereits verstorbenen Angehörigen; die Personen wurden oftmals selbst darüber nicht informiert.
Die Regierung in Den Haag hat aus Datenschutzgründen die teilweise Veröffentlichung des Archivs am 2. Januar gestoppt, die mit der vollständigen Digitalisierung der 30 Millionen Seiten des CABR eigentlich bis 2027 abgeschlossen werden sollte. Dieser Entscheidung ging ein Warnschreiben der niederländischen Datenschutzbehörde voraus – wegen Bedenken hinsichtlich der persönlichen Daten noch lebender Personen in dem Archiv. Denn obwohl die mutmaßlichen Kollaborateure bereits verstorben sein müssen, damit ihre Prozessakten ohne Erlaubnis Teil des digitalisierten Archivs sind, können einzelne Angaben über sie durchaus zu noch lebenden Nachfahren führen.
Kulturminister Eppo Bruins will das niederländische Archivgesetz dementsprechend ändern. So soll das private und das öffentliche Interesse abgewogen werden können, wenn Archivdienste personenbezogene Daten bereitstellen. Einen Zeitraum nannte der Minister dafür nicht. Erst Ende Dezember entschied sich Bruins in Absprache mit der Datenschutzbehörde für einen Zwischenschritt: Demnach sollen Verwandte und Forscher bereits Zugang zu dem digitalisierten Teil des CABR Anfang des Jahres bekommen. Das soll aber weiterhin unter Aufsicht in dem Nationalarchiv in Den Haag geschehen, Kopien der Dokumente seien verboten. Grundsätzlich sprach sich Bruins aber für die Digitalisierung des CABR aus: „Um die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg lebendig zu halten, ist es wichtig, den Niederländern den Zugang zu diesen Informationen auf eine zugängliche Weise zu ermöglichen“ – auch für den Kampf gegen Antisemitismus.
Der Druck ist groß. Nicht nur das Nationalarchiv hat gegen die Entscheidung der Regierung protestiert und darauf hingewiesen, dass die Digitalisierung von einem Ethikrat begleitet worden sei. Auch andere Teile der niederländischen Gesellschaft bekräftigen ihr Interesse am öffentlichen Zugang zum CABR: Der Centraal Joods Overleg, vergleichbar mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, schrieb in einer Erklärung, dass die Organisation „zutiefst enttäuscht“ sei über den vorläufigen Stopp der Veröffentlichung des Archivs. „Die Zeit läuft uns davon, es sind jetzt 80 Jahre vergangen“, sagt der Ratsvorsitzende Chanan Hertzberger.
Ein später Heilungsprozess
„Antisemitismus wird als großes Problem gesehen“, stellt van der Bles vom ARQ Nationalen Zentrum für Psychotraumata fest. Drei Viertel der jüdischen Bevölkerung in der Niederlande wurden während des Zweiten Weltkriegs ermordet. Das würde im Land zu einem „kollektiven Schuldbewusstsein gegenüber der jüdischen Bevölkerung“ führen. Die Nachfahren der Kollaborateure seien aber auch Opfer, hebt sie hervor; für sie habe es keinen Platz in der Gesellschaft gegeben. „Die Öffnung der Archive und die Bekanntmachung dieser bedeutet die Öffnung einer gesellschaftlichen Debatte.“
Van der Bles hat mit einer Studie herausfinden wollen, inwieweit sich die Kriegsgeschichte noch immer auf das Leben der Kinder von Kollaborateuren auswirkt. Einige Familienangehörige würden die Veröffentlichung des CABR nicht wollen, sagt sie. Sie hätten große Sorge davor, dass die Familiengeschichte für alle zugänglich ist. Das Schamgefühl sei bereits auf die nächste Generation übergegangen.
Van der Bles schildert Erfahrungen einzelner Nachfahren: „Ein Teil der Kinder und Enkelkinder der Kollaborateure ist von der Gesellschaft ausgeschlossen worden oder wurde zum Beispiel gemobbt oder hat eine Absage bei einer Jobbewerbung wegen des Familiennamens bekommen.“ Das habe auch psychologische Auswirkungen auf die Kinder und Enkelkinder der Kollaborateure, beobachtet sie. Das Ergebnis der Studie bekräftigt die gesellschaftlichen Folgen der Besatzungszeit, die sich bis heute halten: Ein Fünftel der niederländischen Bevölkerung will demzufolge nicht, dass Kinder von Eltern mit Kollaborationsvergangenheit öffentliche Ämter etwa in der Politik bekleiden. Man müsse darüber sprechen, dass Kinder nicht für die Taten der Eltern verantwortlich seien, sagt van der Bles. „Dann kann die Gesellschaft erst einen Heilungsprozess beginnen.“
Für Michael Schuling begann der Heilungsprozess, nachdem er herausgefunden hatte, was in der Vergangenheit passiert war. Er kenne nun nicht nur die wahre Geschichte seines Großvaters und verstehe seine Großmutter besser, sagt Schuling, sondern er fühle sich auch seinem Vater näher, der immer Probleme mit der eigenen Identität gehabt habe. Sein Vater sei in einer der ersten Kliniken des „Lebensborn“-Programms des SS-Führers Heinrich Himmler geboren worden. Dort sollte die Geburt „arischer“ Kinder von alleinstehenden Frauen unterstützt werden. „Er geriet immer wieder in Schwierigkeiten mit seinem Verstand“, erzählt Schuling über seinen Vater. „Er schrie nach Hilfe.“ Er habe aber nie die Antworten bekommen, nach denen er gesucht habe – und die Schuling jetzt hat.







