Der Barbetreiber im befreiten Damaskus
Die Straßen von Damaskus sind in Dunkelheit getaucht, kaum ein Auto ist auf der Straße. Das Regime ist erst vor wenigen Tagen kollabiert, viele in der syrischen Hauptstadt sind verunsichert. Im „Sugar Man“ aber brennt Licht. „Hier wird etwas Großes passieren“, hatte ein Gast aus der Nachbarschaft orakelt. Die Szenen in der kleinen Bar, gelegen in einer Seitenstraße, sind tatsächlich überwältigend. Hier wird an diesem Abend die Freiheit gefeiert. Betreiber Kifah Zeni, genannt Zino, steht hinter dem Tresen, sorgt für Musik und Getränke. „Heute ist ein guter Tag!“, jubelt er.
Es ist die erste Nacht im „Sugar Man“ seit dem Umsturz. Kifah Zeni ist in Spendierlaune, schenkt den Whiskey auch mal gern direkt in den Mund der ausgelassenen Gäste. Künstler, Intellektuelle, Kommunisten liegen einander in den Armen, tanzen, singen, verfluchen Baschar al-Assad. Zeni, 34 Jahre alt, hat nicht nur lange im Damaszener Nachtleben gearbeitet und dort 2014, inmitten des Kriegs, eine Bar eröffnet. Er hat auch in Saudi-Arabien und Libanon als Trainer und Regisseur für Performance-Künstler gearbeitet. Das „Sugar Man“ ist – zumindest in dieser Nacht – ein Leuchtturm der Hoffnung für Leute, die sich lange auf die Zunge beißen mussten.

Kifah Zeni hatte Zweifel, ob es eine gute Idee wäre, die Schnapsflaschen wieder ins Regal zu stellen und weiterzumachen. Schließlich hatten Islamisten in Damaskus die Macht übernommen, angeführt von einer Allianz mit dschihadistischen Wurzeln: Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Mehrere Tage versteckte Zeni die Spirituosenvorräte bei sich zu Hause. Doch dann zwang ihn der wirtschaftliche Überlebensdruck, unter dem viele seiner Landsleute leiden, dazu, seine Sorgen beiseitezuschieben. „Ich hatte keine Wahl, ich musste Geld verdienen“, sagt er. Also rief er seine Freunde an und sagte ihnen, er werde die Bar wieder öffnen. „Eine sagte, ich sei verrückt“, berichtet Zeni. Doch am Ende war das „Sugar Man“ rappelvoll, erfüllt mit Freude, und hatte bis spät in die Nacht geöffnet.
Einige Tage nach dieser Nacht hatte Zeni seine erste Begegnung mit den neuen Machthabern. „Zwei Leute von HTS mit Waffen kamen zum Laden“, sagt er. „Die Gäste bekamen Panik, wir machten die Musik aus.“ Die Bewaffneten hätten nach einer Lizenz für den Ausschank von Alkohol gefragt. „Ich sagte ihnen: Kommt schon, das hier ist Damaskus, wir arbeiten ohne Sondererlaubnis.“ Er habe spüren können, dass auch die beiden unerwünschten Besucher angespannt gewesen seien. „Also habe ich gelächelt und sie gebeten hereinzukommen.“ Nur die Waffen sollten draußen bleiben.
Und wieder fühlt sich Zeni in seinem Mut bestätigt. Die Männer hätten wirklich an einem der Tische Platz genommen, Gäste hätten sie freundlich begrüßt, ihnen gedankt, dass sie den verhassten Diktator gestürzt hätten. „Es war verrückt“, sagt Zeni. „Wir haben uns am Ende wie ganz normale Syrer über Dinge wie Autopreise unterhalten.“ Kifah Zeni traut den Islamisten trotz allem nicht. „Alles ist unsicher“, sagt er über die Zukunft. „Wir warten.“ Aber vorerst gehen die Freiheitsfeiern im „Sugar Man“ weiter.
Die Chefdramaturgin des Theaters in einer AfD-Hochburg
Als Sophie Oldenstein 2019 von Bayern nach Thüringen zog, um Chefdramaturgin am Theater Altenburg Gera zu werden, wurde sie immer wieder gefragt, ob sie das wirklich machen wolle. Oldenstein antwortete: „Ja, denn wenn man Theater ernst nimmt, muss man das überall machen – und gerade hier. Auch, um nicht ganze Landstriche den Rechtspopulisten zu überlassen.“ Seither ist Thüringen immer weiter nach rechts gedriftet; bei der Landtagswahl im Herbst wurde die AfD erstmals stärkste Kraft. Mehr als ein Drittel der Menschen haben die dort als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei gewählt. Oldenstein sagt: „Was oft untergeht: 70 Prozent haben was anderes gewählt.“ Sie will den Fokus lieber auf die positiven Entwicklungen legen.
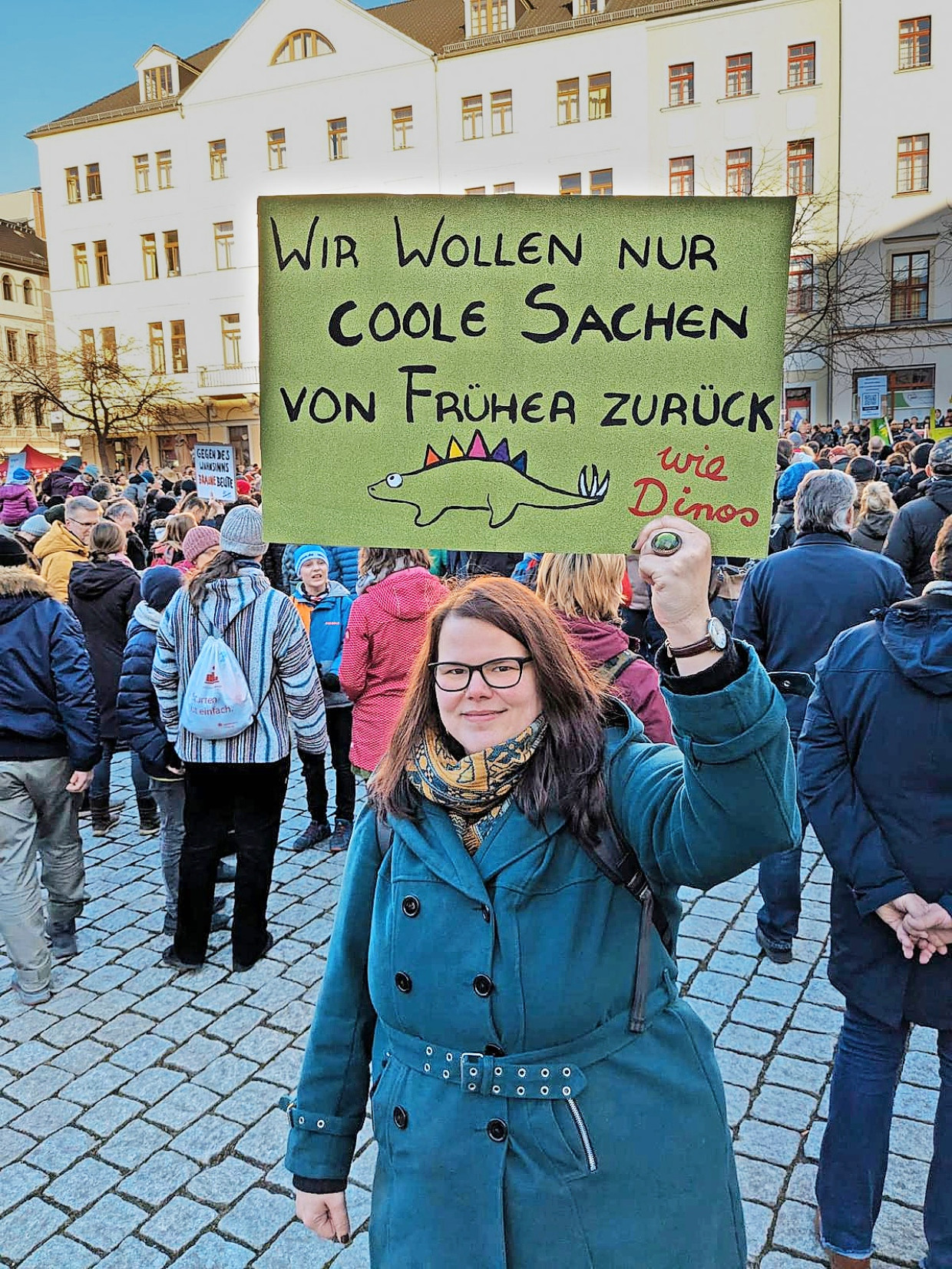
Und von denen gibt es auch in Gera einige. Zum Beispiel, dass nach dem Einbruch durch die Pandemie nun endlich wieder viele Schulklassen ins Theater kommen. Und dass der Theatervorplatz inzwischen nicht mehr Aufmarschgebiet für Rechtsradikale ist. Seit der Corona-Pandemie beendeten Hunderte Reichsbürger, Coronaleugner und Rechtsextreme hier jeden Montag ihren Protestzug. Im Sommer aber gab es Ärger mit dem Ordnungsamt. Seither hat das Aktionsbündnis „Gera gegen rechts“ montagabends den Platz vorm Theater reserviert.
Im September veranstalteten sie eine „Theatervorplatzolympiade“ mit Dosenwerfen und Eierlaufen, zu gewinnen gab es Zuckerwatte. Im Dezember wurde auf dem Theatervorplatz gemeinsam gesungen und Glühwein getrunken. Immer waren auch Theatermitarbeiter dabei. Vorher hatten sie bloß ein Banner mit der Aufschrift „Nie wieder ist jetzt“ an der Fassade befestigen können – und Trost darin gefunden, dass es auf Aufnahmen der Montagsdemos zu sehen war. Nun, sagt Oldenstein, könne man mit den bunten Festen auf dem Vorplatz nicht mehr bloß zeigen, wogegen man sei, sondern auch wofür: Vielfalt und Demokratie. Diese Werte will Oldenstein auch auf der Bühne zeigen. Man darf sich die Sechsunddreißigjährige, die wenige Tage vor Weihnachten an einem langen Probetag etwas Zeit für ein Telefonat findet, aber nicht als kämpferische Aktivistin vorstellen. Zuallererst ist Sophie Oldenstein Theaterliebhaberin. „Und Theater macht man für alle“, sagt sie.
Mit ihren Stücken will sie so viele Menschen wie möglich erreichen. Das könnte sie nicht, würden sich die Stücke eindeutig gegen rechts positionieren. Da ist Kreativität gefragt – wie bei „√My“, einem Theaterexperiment zum Mitmachen in drei Episoden. Die Geschichte: Auf einer weitgehend unbewohnbaren Erde hat sich ein autoritärer Stadtstaat erhalten. Gegen das System begehren eine Gruppe Rebellen auf und eine Gruppe, die sich humanistischen Idealen verschrieben hat. Das Besondere: Die Zuschauer entschieden mit, wie es weitergeht. „So entstanden politische Diskussionen, die losgelöst waren von aktuellen Fragen“, erzählt Oldenstein. „Für uns stand im Zentrum zu zeigen, dass jede Stimme zählt und es sich lohnt, sich einzumischen.“ Die allermeisten entschieden sich für die humanistische Gruppe, die nach friedlichen Lösungen sucht. Auch das macht Sophie Oldenstein Hoffnung fürs kommende Jahr.
Die Sanitäterin in einer Brigade der ukrainischen Streitkräfte
Ob Viktoria Kovach ins neue Jahr hineinfeiern wird, weiß sie noch nicht. Und auch nicht, wo sie dann sein wird. „Das hängt ganz davon ab, wie sich die Situation entwickelt“, sagt die Einunddreißigjährige. Sie leitet den Sanitätsdienst der 3. Sturmbrigade der ukrainischen Streitkräfte, die in der Ukraine eine ziemliche Popularität erlangt hat, auch weil sie ein intensives Marketing betreibt. Im ganzen Land sind die Werbeplakate der „Tretja Sturmowa“ zu sehen, die zum Eintritt in die Brigade auffordern. Derzeit ist Kovach mit ihren Kameraden im Osten der Ukraine stationiert, dort, wo die russische Armee seit Monaten massiv angreift und Gelände zu gewinnen versucht. Gleich am ersten Tag des russischen Überfalls auf ihr Land habe sie sich der Armee angeschlossen, erzählt Kovach. „Ich weigere mich, in einem anderen Land als einer unabhängigen Ukraine zu leben.“ Ins Ausland zu gehen komme für sie nicht infrage und schon gar nicht ein Leben unter irgendeiner Besatzung.

Die Notwendigkeit, ihr Land zu verteidigen, kam bereits früh auf sie zu: Als nach der Krimannexion russische Freischärler vor zehn Jahren in den Osten der Ukraine eindrangen und Kommunalverwaltungen kaperten, ging Kovach als Sanitäterin zur Armee, die die Eindringlinge wieder zu vertreiben suchte. Damals war die in der Westukraine aufgewachsene und ausgebildete Ärztin in der Nähe der Hafenstadt Mariupol eingesetzt. Heute sei sie in vielerlei Hinsicht Krisenmanagerin und Verwalterin, die meisten Dinge an der Front mache auch sie zum ersten Mal in ihrem Leben, sagt sie. „Und natürlich muss ich unter ständig wechselnden Bedingungen und unter feindlichem Beschuss arbeiten.“ 2024 sei ein sehr schwieriges Jahr gewesen. „Die ständige Müdigkeit fordert Tribut, die Herausforderungen werden größer, aber einfach aufzugeben würde bedeuten, dass ich meine und die Zukunft meines Landes verliere.“ Das will sie auf gar keinen Fall.
Im vergangenen Jahr habe sie viel gelernt, an Erfahrung gewonnen und gekämpft. „Das alles hat mich effektiver gemacht und besser auf das vorbereitet, was noch kommt.“ Am meisten schmerze sie der Verlust von Bekannten und auch Fremden. So viele Tote haben sie sehen müssen, Soldaten und Zivilisten, denen sie nicht mehr helfen konnte. „Es ist ein Terror-Staat, der ihnen das Leben genommen hat, und er darf damit nicht durchkommen!“ Für das kommende Jahr erwarte sie noch größere Härten als bisher, aber ihr Weg sei der richtige, sagt sie überzeugt. Wenn alle Beteiligten „endlich ihre Unreife ablegen und die Gefahr, die Russland für die Welt darstellt, erkennen würden und nüchtern ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen“, dann werde es am Ende auch wieder eine freie und unabhängige Ukraine geben. „Ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen können“, sagt Viktoria Kovach. „Für 2025 wünsche ich mir deshalb nur eines: durchhalten und gewinnen.“
Der langjährige VW-Mitarbeiter und IG-Metall-Vertrauensmann
Thorsten Donnermeier geht es wie vielen anderen Menschen mit ihrer Arbeit: „Man ärgert sich immer wieder. Und es tut einem oft der Rücken weh.“ Und doch ist die Arbeit für ihn mehr als das. Denn Thorsten Donnermeier arbeitet, wie vor ihm schon sein Vater, bei VW. „Man kennt die Leute dort jahrzehntelang, mit ihren Familien. Wenn ich Geburtstag feier, sind über die Hälfte der Gäste bei VW oder einem Zulieferer beschäftigt“, erzählt Donnermeier in einem Videoanruf. VW, sagt Donnermeier, das sei in gewisser Weise Familie. Doch die Familie droht es gerade zu zerreißen. Das einstige Vorzeigeunternehmen steckt in einer schweren Krise, bis 2030 werden mehr als 35.000 Stellen abgebaut – für Donnermeier ein „Arbeitsplatzmassaker“. Werksschließungen drohen nach einer Einigung zwischen Unternehmen und Gewerkschaft zwar nicht unmittelbar, aber können bei der derzeitigen Lage auch nicht ausgeschlossen werden.

Über Donnermeiers breitem Mund, der immer zu einem Lächeln verzogen scheint, thront ein kräftiger Schnauzer. Im Video sind hinter ihm die Dachbalken eines historischen Fachwerkhauses zu sehen: Donnermeier lebt auf einem Dorf bei Kassel; im VW-Werk Baunatal arbeitet er in der Qualitätssicherung. Noch sei die Auftragslage in dem Komponentenwerk gut, sagt Donnermeier. Doch er fürchtet, dass die Getriebegehäuse und Strukturteile, die er auf ihre Qualität prüft, künftig immer weniger gebraucht werden. Denn Elektroautos, auf die VW umstellen muss, wenn es konkurrenzfähig bleiben will, haben weniger Einzelteile als Verbrenner.
Trotzdem blickt der VW-Mitarbeiter hoffnungsvoll ins neue Jahr. Denn der 56 Jahre alte Donnermeier – wie schon sein Vater Vertrauensmann für die IG Metall und seit 40 Jahren bei VW – ist ein Kämpfer. Und er glaubt, dass das für viele Beschäftigte gilt. „Es ist unser VW-Werk“, sagt er. „So viele sind damit aufgewachsen. Denen wurde als Kinder gesagt ,Heute nicht laut spielen, der Papa hatte Nachtschicht‘, und heute arbeiten sie selbst bei VW.“ Eine Werksschließung, ist er überzeugt, würde sich die Belegschaft gar nicht gefallen lassen. Sondern sich dafür einsetzen, dass die abnehmende Arbeit auf dieselben Schultern verteilt wird. Das könnte etwas Gutes sein, hofft er, wie die Einführung des Achtstundentags vor 150 Jahren. Das zeigt: Donnermeier ist auch ein Optimist.
„Es wird sicherlich immer Autos geben, für Orte, an die man sonst nicht kommt“, ist Donnermeier überzeugt. Aber trotzdem glaubt er an eine Zukunft, in der es mehr Busse und Bahnen auch auf dem Land gibt und weniger Autos, egal ob mit Motor oder Batterieantrieb. Mit dem Wissen, das sie in Baunatal haben, könnte man auch Zugteile fertigen, sagt Donnermeier. Oder etwas ganz anderes. Solarpaneele und Lastenräder zum Beispiel, wie in einem früheren Autoteile-Werk von GKN in Florenz, das die einstigen Arbeiter übernommen haben. Ein Idealist ist Donnermeier auch. 2025 wird er all diese Eigenschaften sicherlich brauchen können.
Die christliche Palästinenserin im besetzten Westjordanland
Shadin Nassar, 25, ist in Bethlehem und auf dem Gut ihrer Familie im Umland aufgewachsen. Das Land kaufte ihr Urgroßvater 1916, als Palästina noch Teil des Osmanischen Reichs war. Doch seit 30 Jahren wächst der Siedlungsblock Gusch Etzion um das Familienland, das im vollständig von Israel kontrollierten C-Gebiet des Westjordanlands liegt. Während die fünf israelischen Siedlungen, in denen Siedler volle Bürgerrechte haben, zu Städten heranwachsen, dürfen die Nassars auf ihrem eigenen Land nichts bauen, keine Wasser- und Stromleitungen verlegen. „Uns werden die grundlegendsten Dinge verwehrt, weil wir Palästinenser sind und israelischem Militärrecht unterstehen“, sagt Shadin Nassar. Auch deshalb hat sie sich entschlossen, internationales Recht und Diplomatie zu studieren.

In diesem Jahr sind mehrere Wohnblöcke in Gusch Etzion fertiggestellt worden, und Siedler haben unter dem Schutz der Armee begonnen, eine Straße mitten durch das Land der Familie Nassar zu bauen. Die Nassars sind, wie schon oft, vor israelische Gerichte gezogen, um einen Baustopp der illegalen Straße zu erwirken. „Das hat die Siedler so wütend gemacht, dass sie nach dem Urteil Olivenbäume zerstört haben“, erzählt die Studentin. Seit radikale Siedler Teil der Regierung geworden sind und seit Israel wegen des radikalislamistischen Terrorangriffs am 7. Oktober Krieg in Gaza führt, seien sie noch aggressiver geworden. Immer wieder hätten nicht nur Siedler, sondern auch israelische Behörden versucht, sie von ihrem Land zu vertreiben.
Schon 2014 hatten Siedler fast den gesamten Obstbaumbestand der Familie zerstört. „Ich war gerade 14 Jahre alt und dachte, das sei das Ende, aber mein Vater hat beschlossen, einfach doppelt so viele Bäume neu zu pflanzen“, erzählt Shadin Nassar. „Wann immer wir angegriffen werden, bauen wir alles wieder auf und säen neu aus. Das ist Sumud, das palästinensische Ethos der Standhaftigkeit“, so Nassar. „Als christliche Familie im Heiligen Land haben wir Generationen auf diesem Land gelebt – unter Osmanen, Briten, Jordaniern. Wir haben viele Besatzungen überstanden, und das gibt mir Hoffnung, dass wir auch in Zukunft hier leben werden“, sagt Nassar.
Schon 2001 hat ihr Vater Daoud Nassar das gemeinnützige Projekt „Tent of Nations“ initiiert — mit Freiwilligen aus aller Welt werden auf dem Familienland Bildungsprojekte für benachteiligte Menschen aus der Region umgesetzt. Langfristig soll das „Tent of Nations“ zu einem ökologischen Bildungszentrum werden, für das nächste Jahr sind Pflanzkampagnen, Sommercamps und Ernten geplant. „Wir wollen, dass Menschen kommen und sehen, wie wir leben und was wir entgegen aller Widrigkeiten aufbauen — und über das, was sie hier sehen, sprechen und vom christlichen Geist inspiriert werden, gemeinschaftlich zu leben, egal, wo sie hingehen“, sagt Shadin Nassar.







