Wenn Mercedes-Chef Ola Källenius mit Blick auf die geopolitische Lage, die konjunkturelle Situation und den scharfen Wettbewerb die Aussichten für 2025 beschreibt, beschönigt er nichts: „Das Gute ist: Wir haben die vergangenen fünf sehr erfolgreichen Jahre genutzt, um Mercedes resilienter und profitabler aufzustellen. Diesen Weg gehen wir unaufgeregt, aber konsequent weiter.“
Keinen Zweifel lässt er daran, dass die gesamte europäische Automobilindustrie vor einem entscheidenden Jahr steht – dass das aber mittlerweile auch politische Entscheider erkennen. „Ich spüre in den Brüsseler Institutionen ein wachsendes Bewusstsein für die Bedürfnisse der Branche. Es wäre wichtig, dass sich das auch in einer pragmatischen Diskussion über die Kohlendioxid-Ziele der EU sowie einem Abbau der lähmenden Überregulierung niederschlägt“, sagt Källenius der F.A.Z. „Die EU muss deshalb sehr schnell aktiv werden und die richtigen Rahmenbedingungen und Anreize setzen, damit die Dekarbonisierung der Autoindustrie zu einem profitablen Geschäftsmodell wird.“ Er fordert dafür einen „marktorientierten Ansatz – und keinen, der primär auf Strafen basiert“.

Was Gespräche mit Donald Trump angeht, ist der Mercedes-Chef bedeutend zurückhaltender. „Wir setzen weiterhin auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit, auch mit der neuen US-Administration.“ Klar sei, dass die vom nächsten amerikanischen Präsidenten angedrohten Handelszölle Mercedes schwer belasten würden. Rund 50 Prozent der in den USA verkauften Fahrzeuge stellt das Unternehmen außerhalb Amerikas her. „Wie bei jedem global agierenden Unternehmen basiert unser Geschäftsmodell auf fairem und freiem Handel. Protektionismus und Handelsbarrieren wirken sich auf längere Sicht negativ aus, nicht zuletzt in Form von höheren Preisen“, sagt Källenius und verweist darauf, dass Mercedes einen Großteil seiner SUVs für den Weltmarkt in den USA herstellt und somit ein großer Exporteur ist.
An die Adresse der neuen Bundesregierung sendet Källenius vier Wünsche: eine Stärkung des heimischen Standorts verbunden mit einer kohärenten Wirtschaftspolitik; mehr Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung und erneuerbare Energien; drittens deutlich flexiblere Regelungen für den Arbeitsmarkt; viertens müsse die neue Bundesregierung in Brüssel „eine führende Rolle einnehmen, unsere Interessen dort vertreten und auch eine klare Vorstellung haben, wohin sich die EU entwickeln soll“.
Das Dilemma der Transformation
Bei einem für Mercedes drängenden Problem kann allerdings kein Politiker helfen. Das Unternehmen muss 2025 seine Absatzzahlen in China stabilisieren, die zuletzt eingebrochen sind. „Die chinesische Wirtschaft befindet sich nach jahrzehntelangem Wachstum in einer Konsolidierung. Der Markt für E-Autos ist extrem hart umkämpft. Vor allem im Einstiegssegment findet ein darwinistischer Wettbewerb statt“, sagt Källenius. „Wir konzentrieren uns auf höherpreisige Segmente. Mit unseren kommenden Modellen werden wir ein noch individuelleres und attraktiveres Angebot machen: Mehr Raum, mehr Luxus sowie neue, in China für China entwickelte digitale Angebote. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das positiv für uns auswirken wird.“
Wenn bei Mercedes, Volkswagen, Ford und Co. die Fabriken nicht ausgelastet sind, trifft das in hohem Maße ihre Lieferanten. Dort zeigt sich das ganze Dilemma der Transformation: Das Geschäft mit der Verbrennertechnik schrumpft, doch die Teile für Elektroautos gleichen den Rückgang nicht aus. Fast alle großen Zulieferer bauen derzeit Stellen ab, so auch Schaeffler in Herzogenaurach. Das fränkische Familienunternehmen, einst spezialisiert auf Kugel- und Wälzlager, wird durch die Übernahme des Regensburger Antriebsstrangspezialisten Vitesco zu einem Schwergewicht in der Autozulieferung: Aus dem Zusammenschluss entsteht ein Lieferant für E-Achsen und Hybridmodule für Elektroautos samt Industriesparte mit mehr als 25 Milliarden Euro Umsatz und 120.000 Mitarbeitern in 55 Ländern.
In der aktuellen Misere streicht der Schaeffler-Vorstand um den Vorsitzenden Klaus Rosenfeld aber 4700 Arbeitsplätze in Europa – 600 davon aufgrund der Vitesco-Übernahme, weil einige Funktionen doppelt besetzt sind. „Die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen werden auch 2025 von Unsicherheit, Volatilität und Komplexität geprägt sein. Um in diesem Umfeld Erfolg zu haben, müssen wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir am besten können“, sagt Rosenfeld. „Durch den Zusammenschluss mit Vitesco haben wir unser Technologie-Portfolio signifikant verbreitert und verstärkt. Das macht uns zuversichtlich.“
„EU braucht mehr Einigkeit“
Auch Martin Herrenknecht – immer schon ein Freund offener Worte – geht zuversichtlich ins neue Jahr. „Ich bleibe optimistisch. Die Hängepartie der Ampel hat endlich ein Ende, und wir wählen im Februar eine neue Regierung“, sagt der Chef der Herrenknecht AG. „Das ist die letzte Chance, zurück zu einer wirtschaftsfreundlichen, leistungsorientierten Politik zu finden, die Innovationen ,Made in Germany‘ fördert.“ Eines der wichtigsten Projekte im nächsten Jahr ist der Bau einer Maschine für den Ausbau des U-Bahn-Netzes im Großraum San Francisco.
Zurzeit entsteht sie am Stammsitz des weltweit einzigen nichtchinesischen Herstellers von Tunnelvortriebsmaschinen im badischen Schwanau. Es ist die größte Maschine, die jemals dort gebaut wurde. Neben dem Kerngeschäft für Großmaschinen konzentriert sich das Unternehmen, das 2023 mit rund 5000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftete, vor allem auf Projekte in der Wasser- und Energieversorgung.
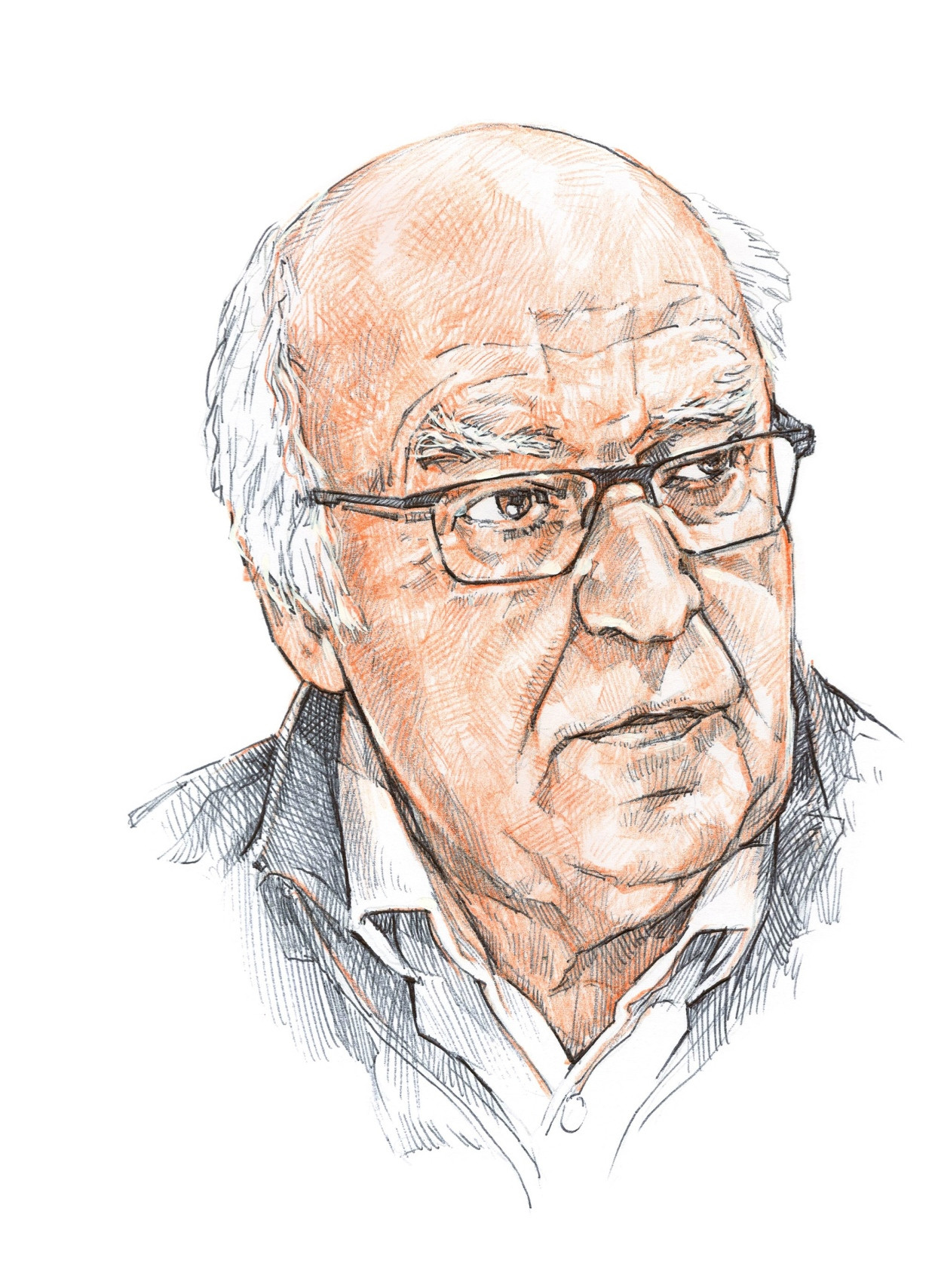
Was Donald Trump angehe, müsse die EU zu mehr Einigkeit finden, sagt Herrenknecht. „Trump ist Unternehmer, er versteht wirtschaftliche Dynamiken und wird dieses Verständnis nicht zugunsten von Europa einsetzen.“ Und weiter: „Wir müssen uns endlich stärker positionieren, uns wirtschaftlich gegenseitig stützen – getreu dem Motto Europe First.“ Konkret bedeute dass, dass die EU bei europäischen Projekten die Wertschöpfung innerhalb Europas belassen müsse und kritische Aufträge nicht an Drittländer wie China abgeben dürfe.
Für Deutschland wünscht sich Herrenknecht einen „Kurswechsel hin zu mehr Leistungsorientierung und Eigenverantwortung“ – und eine Abschaffung des Bürgergeldes, um dafür Arbeitnehmer stärker zu honorieren. „Ich sage schon lange, dass wir gerade die unteren Lohngruppen entlasten sollten. Mein Vorschlag ist deshalb, bei einer Wochenarbeitszeit von 38 Stunden zusätzlich fünf Überstunden steuerfrei zu vergüten.“ Und wer soll Deutschland künftig regieren? „Ganz klar eine Regierung unter CDU-Führung.“ Es sei „höchste Zeit, dass Deutschland wieder zum Wachstumsmotor Europas wird – mit einer Regierung, die Probleme pragmatisch löst, statt sie mit ideologiegetriebener Symbolpolitik zu überdecken“.
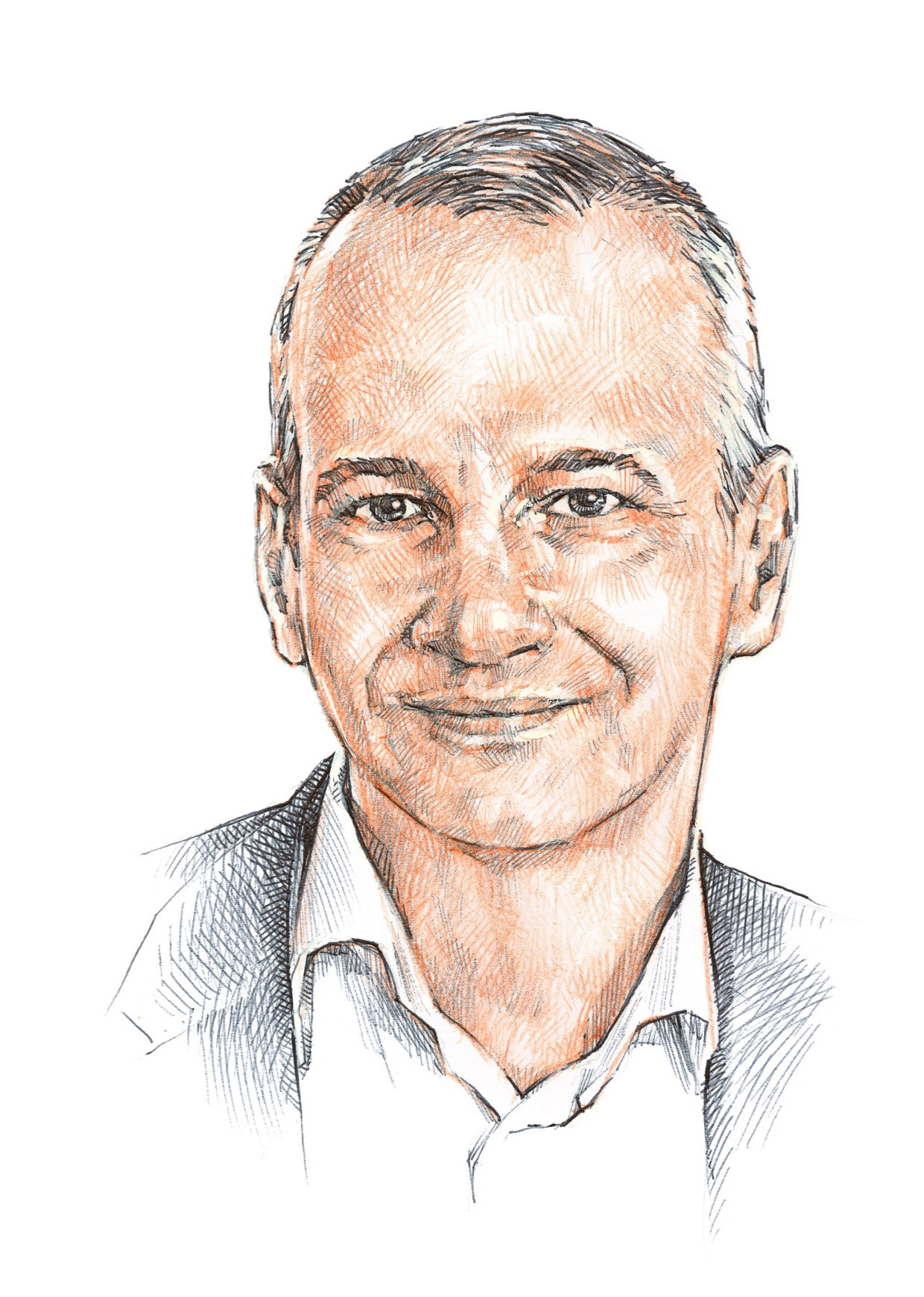
BASFIllustration Bernd Schifferdecker
Für eine andere Branche, die Chemieindustrie, werde 2025 „wieder kein leichtes Jahr“, so der neue Vorstandsvorsitzender von BASF, Markus Kamieth. „Aber es gibt viel, das wir selbst für den Erfolg tun können.“ Das nächste Jahr stehe im Zeichen der neuen Strategie, zu der der Fokus auf neu definierte Kerngeschäfte gehört, die grüne Transformation der Prozesse und mehr Effizienz. Er sei sich bewusst, „dass wir dies gegen die Hürden wirtschaftlicher Schwierigkeiten und geopolitischer Herausforderungen schaffen müssen“. Aber der Konzern habe ein „motiviertes Spitzenteam, Innovationskraft und einen strategischen Plan“, wie jedes Einzelne der Geschäftsfelder erfolgreich bleiben oder werden könne.
Das gilt nach Kamieths Worten auch für den größten Standort Ludwigshafen mit seinen rund 39.000 Beschäftigten, der dem Konzern in den vergangenen Jahren Milliardenverlust bescherte. Allen sei klar, dass BASF durch einen Transformationsprozess gehen müsse. „Anlagen, die im Wettbewerb nicht bestehen könnten, werden wir schließen. Andere werden wir fit machen.“ Die meisten Anlagen würden auch in Zukunft zum Erfolg beitragen, das sei die gute Nachricht. „Wenn ich mir die Zukunft der BASF vorstelle, dann habe ich ein global erfolgreiches Unternehmen vor Augen, mit einem schlankeren, aber stärkeren Standort Ludwigshafen“, sagt Kamieth.
Veränderungen beschleunigen
Auch Christian Klein will das Augenmerk im neuen Jahr vor allem auf Chancen und Möglichkeiten legen. Und das, obwohl „politische Neuanfänge, geopolitische Unsicherheiten, der Klimawandel und die Migrationsfrage“ Deutschland und die Welt intensiv beschäftigen würden. Der Vorstandschef von SAP , Deutschlands wertvollstem börsennotierten Konzern, betont nach einem für sein Unternehmen sehr erfolgreichen Börsenjahr das große Potential der deutschen Wirtschaft. „Das sollten wir in Zeiten, in denen Kritik und Krisenstimmung überwiegen, auf keinen Fall vergessen.“

SAPIllustration Bernd Schifferdecker
Deutschland verfüge über einen riesigen Schatz an Können und Wissen – und Industriedaten. Technologien wie die Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) böten große Chancen, dieses Potential zu heben und „schon lange fällige Veränderungen zu beschleunigen“. Klein nennt konkret die schleppende Digitalisierung und sinkende Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen und öffentliche Verwaltung müssten ihre Prozesse modernisieren, effizienter und zugleich nachhaltiger gestalten. Mutige politische Entscheidungen und eine entschlussfreudige, nach vorne schauende Wirtschaft seien der Schlüssel, diese Chancen zu nutzen. „SAP ist bereit, dafür einen starken Beitrag zu leisten – und ich weiß, dass viele andere Unternehmen es auch sind.“
Jürgen Otto hat seinen Plan für das neue Jahr bereits vorgelegt. 450 Stellen will der Vorstandschef von Heidelberger Druckmaschinen streichen. Zugleich kündigt er eine Standortgarantie für die verbliebenen 3500 Beschäftigen an und verspricht Wachstum und Investitionen in Zukunftstechnologie im Stammwerk Wiesloch bei Heidelberg. Heidelberger Druckmaschinen begegne dem Druck durch steigende Personal- und Produktionskosten, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Besonders hart treffe das Unternehmen die staatlich erhöhten Energiekosten, vor allem in der Gussproduktion. „Von der neuen Bundesregierung erwarten wir klare und mutige Schritte“, sagt er. Otto nennt weniger bürokratische Hürden, verlässliche Rahmenbedingungen und eine aktive Industriepolitik, „die den Standort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger macht, vor allem bei Energie- und Personalkosten“. Erfolg werde nicht ohne Schweiß und Tränen zu haben sein – weder für die Politik noch für Unternehmen. „Ein Weiter-so können wir uns nicht leisten, wenn Deutschland seinen Ruf als Exportweltmeister und technologischer Vorreiter nicht einbüßen will. Es braucht einen Neustart für und in Deutschland.“
Es braucht ein neues Mindset
Leonhard Birnbaum sieht das genauso. Wenn für einen Unternehmenslenker die Forderung logisch ist, dass Deutschland 2025 wieder zum „Motor der europäischen Wirtschaft“ werden muss, dann für Birnbaum. Schließlich plant das Energieunternehmen Eon , dem er vorsteht, dass sich seine Investitionen in die Energiewende bis zum Jahr 2028 auf satte 42 Milliarden Euro summieren. „Wachstum ist der Schlüssel, vor allem für die notwendige Transformation zu einer dekarbonisierten Wirtschaft und Gesellschaft“, sagt er. Günstige und sichere Energie sei dafür ein wichtiger Faktor. „Aber es ist bei weitem nicht der einzige.“ Treiber von Wachstum seien darüber hinaus das Arbeitsangebot, Investitionen und Innovation. „Die Bundestagswahl wird hoffentlich zu einer Regierung führen, die uns diesbezüglich voranbringt“, wünscht sich der Chef des Dax-Konzerns.
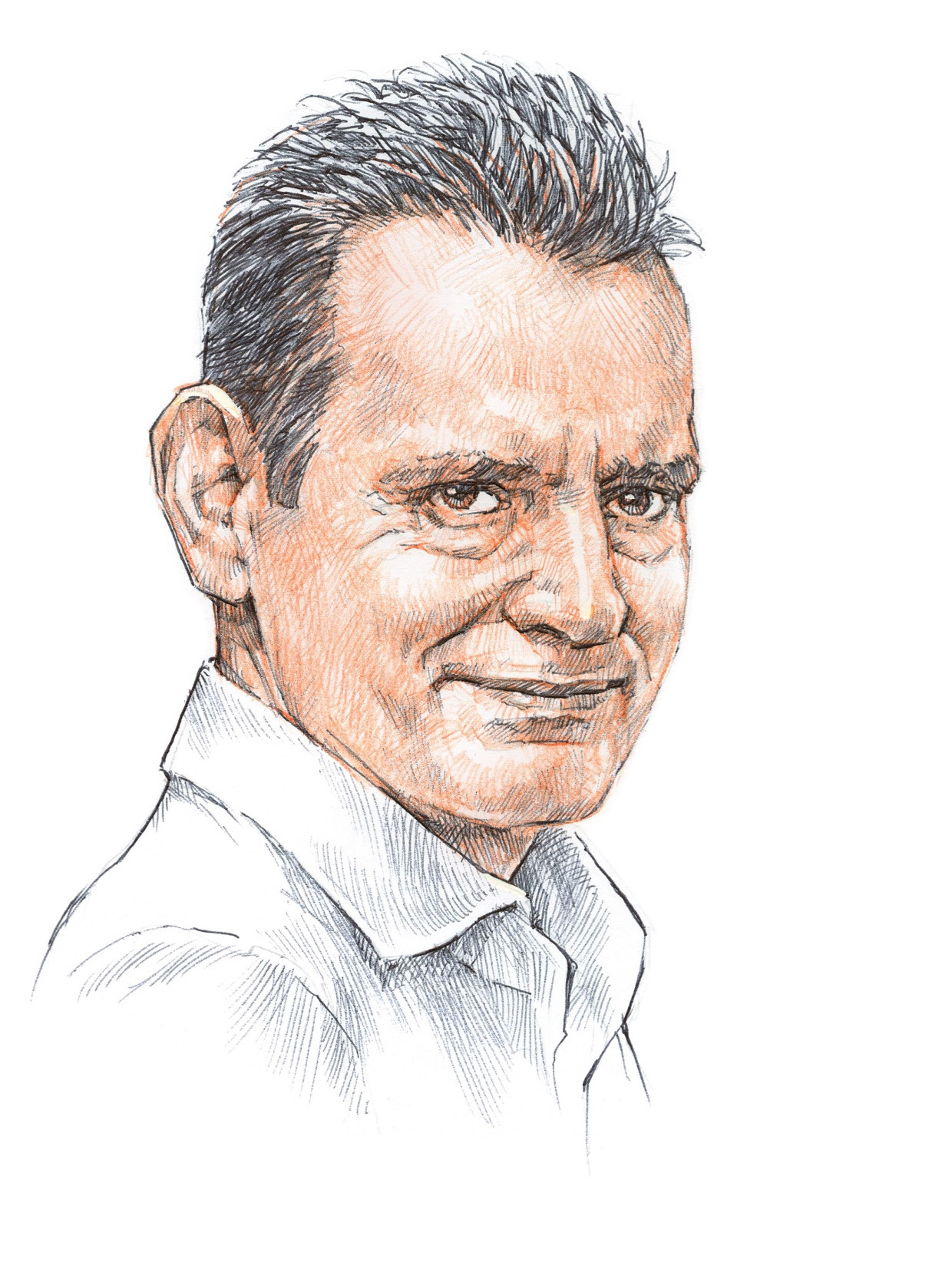
Denn die Politik mache es investitionswilligen Energieunternehmen derzeit nicht leicht. Damit meint Birnbaum nicht nur „die hohen bürokratischen Hürden beim Ausbau von Infrastruktur“, sondern auch „die regulatorischen Rahmenbedingungen für Investitionen in die Energienetze“. Ein in den Ausbau der Energieinfrastruktur investierter Euro müsse so viel erbringen, wie es im internationalen Vergleich üblich sei – und eben auch etwas mehr, „als man auf dem Tagesgeldkonto bekommt“, sagt Birnbaum. Für seine Branche und die gesamte deutsche Wirtschaft fordert er „mehr als das Drehen an einzelnen Stellschrauben“, nämlich ein „neues Mindset“. Er wünsche sich den Mut, auf marktwirtschaftliche Prozesse statt auf „Planerfüllung“ zu vertrauen. „Angesichts der sich vollständig verändernden Weltordnung brauchen wir mehr denn je ein starkes und wettbewerbsfähiges Europa. Für unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand – und natürlich auch für unsere Sicherheit.“
Deutschland muss auf den Wachstumspfad zurückkehren
Die vielen Molltöne aus der Wirtschaft können Michael Sen die gute Laune nicht verderben. Der Gesundheitskonzern Fresenius , den er seit zwei Jahren führt, hat eine Rosskur weitgehend hinter sich. Das Unternehmen sei heute „einfacher, fokussierter und stärker“. Erfolgreicher ohnehin. Die Entflechtung des in der Pandemie in die Krise geratenen Dialysespezialisten Fresenius Medical Care, ein strikter Sparkurs und der Verkauf diverser Randaktivitäten haben dem ehemals in vier Unternehmensbereichen tätigen Dax-Konzern und seinen mehr als 175.000 Beschäftigten viel abverlangt. Doch die Arbeit zahle sich aus, das Unternehmen wachse profitabel. Zudem schreite der Schuldenabbau voran, und auch Zukäufe schließt Sen nicht mehr aus.
Mit der Klinikkette Helios und dem Medizintechnik- und Arzneimittelhersteller Kabi als neue Kernsparten blickt der Fresenius-Chef optimistisch in die Zukunft. Fresenius profitiere von langfristigen Wachstumstrends in der Gesundheitswirtschaft. Deutschland insgesamt müsse „wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren“. Die Gesundheitswirtschaft könne dabei eine entscheidende Rolle spielen, „wenn wir sie zur Leitindustrie entwickeln“, sagt Sen. „Dafür müssen wir sie strategisch stärken und vor allem neu denken.“ Schließlich sei sie eine Wachstumsbranche mit vielen neuen Arbeitsplätzen und leiste einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. „Mit acht Millionen Beschäftigten und einem Anteil von 13 Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung ist sie eine Schlüsselindustrie für unseren Wohlstand.“
Der Münchner Halbleiterhersteller Infineon musste 2024 mehrmals die Erwartungen dämpfen. Die Lagerbestände der Kunden sind weiterhin hoch, entsprechend lässt die Nachfragebelebung auf sich warten. Trotzdem hält der Vorstandsvorsitzende Jochen Hanebeck die strukturellen Wachstumstreiber seines Unternehmens – Dekarbonisierung und Digitalisierung – für intakt, ungeachtet der aktuellen zyklischen Entwicklung. „Wir werden auch im kommenden Jahr voll auf diese Trends setzen“, sagt er. Das Umfeld in Deutschland und nahezu allen anderen Teilen der Erde werde von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt. Als Weltgemeinschaft werde es darauf ankommen, diese Veränderungen zum Positiven mitzugestalten. Gleichzeitig dürfe der Klimawandel als drängendste globale Herausforderung nicht aus den Augen verloren werden. „Wir müssen die Dekarbonisierung konsequent in allen Lebensbereichen vorantreiben. Dabei bietet jede Transformation auch Chancen“, sagt Hanebeck.
Was für alle Unternehmen, Positionen und Branchen gilt: Die Arbeitsintensität hat zugenommen. Hinzu kommt, dass im Spannungsfeld zwischen weitgehend permanenter digitaler Erreichbarkeit von Büroangestellten und den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs im „Stechuhr-Urteil“ die meisten Unternehmen zur Erfassung der Arbeitszeit verpflichtet sind – was für Unsicherheit sorgt. Deshalb wünscht sich Stefan Rizor, Vorstandssprecher des Bundesverbands der Wirtschaftskanzleien in Deutschland, für 2025 und von der nächsten Bundesregierung, dass die „völlig überholte Arbeitszeitrichtlinie“ von 1994 den Erfordernissen der modernen Arbeitswelt angepasst wird. Solche Richtlinien dienten den Bürgern der EU und sollten die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Institutionen und Unternehmen stärken, sagt Rizor. „Sollte dies nicht sofort gelingen, dann sollte die überfällige Novellierung des deutschen Arbeitszeitgesetzes – orientiert an den praxisnahen Modellen unserer EU-Nachbarn – flexible Modelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber ermöglichen.“
Die Unternehmen brauchten Flexibilität, nicht mehr Regulierung. Das Gesetz sieht derzeit für Vollzeitbeschäftigte eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden vor. Zwischen zwei Arbeitstagen muss eine Ruhezeit von elf Stunden eingehalten werden. Ausnahmen gibt es für Landwirte, Erzieher und Krankenpfleger. Vor allem Freiberufler fordern seit Jahren Lockerungen für angestellte Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Mal sehen, was 2025 auch in dieser Hinsicht bringen wird.
Es berichten: Nadine Bös, Bernd Freytag, Markus Frühauf, Marcus Jung, Uwe Marx, Henning Peitsmeier, Vanessa Trzewik und Benjamin Wagener







