Traurige Tannen säumen dieser Tage wieder die Bürgersteige: Weihnachtsbäume a. D. warten auf die Müllabfuhr. Früher boten sie einen noch kläglicheren Anblick, erinnerten doch da oft noch Lamettareste in ihren Zweigen an die Vergänglichkeit alles Festlichen.
Die Stanniolstreifen sind heute zwar nicht verboten, aber doch sehr aus der Mode gekommen: Der letzte deutsche Hersteller traditionellen Zinnlamettas stellte 2015 die Produktion ein – mangels Nachfrage. Ersatzprodukte aus Kunststoff sind zwar noch zu haben, doch würden auch davon jegliche Überbleibsel die Mitnahme durch den Räumdienst verhindern. Außerdem sehen die Plastikfransen schon am Heiligen Abend erbärmlich aus. Es fehlt einfach die metallische Schwere.
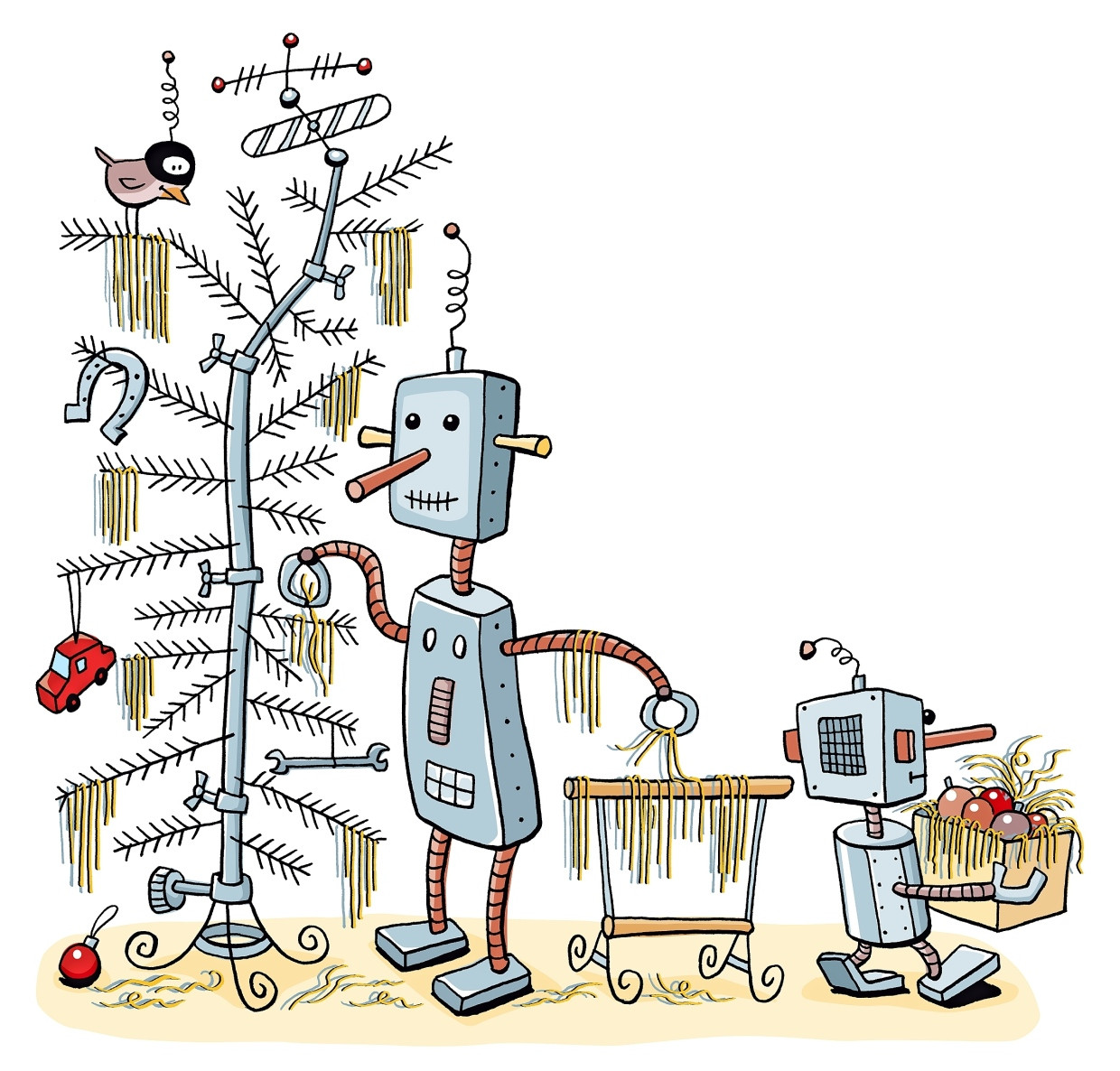
Dabei lieben Tannen Schwermetalle. In einem Kilogramm Holz einer Abies nordmanniana fand eine polnische Studie 2017 fünfzig Milligramm Kupfer. Und in einstigen Bergbaugebieten im Schwarzwald wachsen Silber- und Douglastannen mit Bleikonzentrationen von 120 Milligramm pro Kilogramm. Zum Vergleich: Ein Mensch enthält höchstes zwei Milligramm Kupfer pro Kilogramm Körpergewicht und nur 0,14 Milligramm Nickel, wobei umstritten ist, ob dieses Element für uns essenziell ist oder nicht. Ältere Fachliteratur rät, man solle täglich 0,1 Milligramm Nickel zu sich nehmen, neuere warnt hingegen, es dürfe höchstens ein Milligramm sein. Mehr wäre giftig.
Auch die meisten Pflanzen enthalten höchstens fünf Milligramm Nickel pro Kilo Trockenmasse. Viel mehr vertragen sie nicht, denn Nickel stört Zellteilung und Photosynthese. Dennoch können 515 der rund 250.000 Blütenpflanzenarten gar nicht genug Schwermetalle bekommen: Sie reichern sie bis auf das Hundertfache dessen an, was sich in anderer Vegetation an ihren Standorten findet – und die meisten dieser sogenannten Hyperakkumulatoren haben es auf Nickel abgesehen.
Metall aus dem Erdmantel
Tatsächlich wurde der Begriff „Hyperakkumulator“ erst 1976 in einer Veröffentlichung in Science geprägt, welche bei einer Baumart aus den Regenwäldern Neukaledoniens im Südwestpazifik Unglaubliches feststellte: Pycnandra acuminata – seinerzeit noch unter dem botanischen Namen Sebertia acuminata – sondert bei Verletzungen einen türkisgrünen Saft ab. Seine Farbe erinnert damit nicht zufällig an das dominante Grün der Nickelsalze. Seine Trockenmasse besteht zu 25 Prozent aus diesem Element.
Wie die Pflanze das macht, ist inzwischen erforscht: Sie packt das Metall in Form von Nickelcitrat in separate Kammern, wo es nicht mit dem übrigen Stoffwechsel in Kontakt kommt. Warum sie den Aufwand treibt, ist indessen weniger klar. Neukaledonien besteht zum Teil aus sogenannten ultramafischen Gesteinen, die aus dem Erdmantel stammen und hohe Nickelkonzentrationen aufweisen.
Möglicherweise handelt es sich um eine sogenannte Exadaption: Zuerst zwangen die ultramafischen Böden die Bäume zur Entwicklung einer Nickeltoleranz, die sich dann zu einer regelrechten Nickelsucht verstärkte, nachdem sie der Pflanze noch einen Vorteil bot: den Schutz vor Fraßschäden durch nickelempfindliche Insekten. Eine andere Möglichkeit wäre eine sogenannte Allelopathie: Mit seinem nickelbelasteten Laub behindert der Baum das Gedeihen anderer Pflanzen zum Vorteil seiner eigenen Keimlinge.
Selbstverständlich wurde schon erwogen, Pycnandra acuminata zur sogenannten Phytosanierung nickelbelasteter Böden oder sogar zum „Phyto-Mining“ einzusetzen – immerhin enthalten Saft und Blätter mehr Nickel als jedes Erz. Leider steht dem entgegen, dass die Art in den immer weiter fragmentierten Regenwäldern Neukaledoniens ums Überleben kämpft. Es gibt heute nur noch wenige Hundert dieser Nickelbäume.







